Guardinis 140. Geburtstag – Über den Kampf Gottes mit dem Menschen
Als Romano Guardini sich der Frage der “neuen Schöpfung” widmete, offenbarte er zugleich sein Gottesbild, schreibt Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
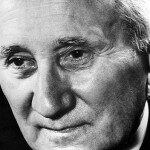
 Über den Kampf Gottes mit dem Menschen | Die Tagespost
Über den Kampf Gottes mit dem Menschen | Die Tagespost
Theologie von Gottes Offenbarung her gedacht | Die Tagespost
Gerl Falkovitz (113)
15.02.2025
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Der Theologe und Religionswissenschaftler Romano Guardini (1885-1968), dessen Geburtstag sich am 17. Februar zum 140. Mal jährt, hat sich mit Christus, dem “Herrn”, erst in der Mitte seines Werkes befasst; zuvor waren Liturgie und Kirche die großen Themen. Als er dann in den 1930er-Jahren endgültig auf ihn stößt, denkt und erfährt er ihn als Kraft des Werdens. Als Kraft des Ur-Anfangs in der Schöpfung: Der Vater schafft alles durch den Sohn. Dann aber ist Christus tiefer noch der zweite Anfang der Welt – denn Erlösung ist “größer als die Schöpfung”. Und ein dritter Anfang ist angekündigt: Der Menschensohn wird die neue Erde und den neuen Himmel schaffen – apokalyptisch, das heißt: alles aufdeckend.
Mit Christus wird ein “zweiter Anfang” gesetzt
Von dem “zweiten Anfang” her skizziert Guardini den “neuen Menschen”, der sich in die Erlösung und Umwandlung der Welt einfügen lässt. Adam und Eva waren zu diesem Werk bestimmt, verfehlten es aber; so muss die Aufgabe erschwert fortgeführt werden, allerdings neu möglich durch die Initiative Christi. Im Werden liegt Freiheit, in der Freiheit entscheidet sich Schicksal, und Guardini wagte es, vom Schicksal Gottes am Menschen zu sprechen. Aber auch vom Schicksal des Menschen an Gott, der sich mit ihm konfrontiert. “Gott ist gar nicht so, daß er eine fertige Wirklichkeit und auszuführende Forderungen entgegenstellt. Sondern er hat die Fülle der fordernden Wirklichkeit und zu erratenden, mit rechter Initiative ( ) zu erfassenden Möglichkeit erzeugt. Die Welt wird tatsächlich so, wie der Mensch sie macht.” Vielen gelingt die Zumutung des Neuen nicht, die Heiligen aber wagen es. Ihre Bedeutung “liegt darin, daß in ihrem Dasein der Vorgang der Neuwerdung, bei uns überall verhüllt und gestört, mit einer besonderen Deutlichkeit, Energie und Verheißungskraft durchdringt.”
Neuwerden geschieht bereits im rechten Gebet: “Etwas von Christus zu erkennen oder in der Nähe des Herrn zu weilen, ist in sich schon ein heiliges Geschehen. So oft irgendein Zug seiner heiligen Gestalt lebendig wird, oder ein Wort von Ihm uns berührt, bedeutet schon das ein inneres Werden.” Daher ist Guardinis Theologie – anders als bei vielen – nicht zuerst Anthropologie, sondern zuerst Rede von der Initiative Christi. Vor ihm hat der Mensch die Knie zu beugen, um dann in ihm herrlich zu werden. Christus ist die Sichtbarkeit Gottes; weder der Vater noch der Geist sind für uns anschaulich.
Aber in Christus kann Gott gesehen werden – aus ihm erhebt sich der “neue Mensch”: “Was heißt Glauben? Aus Christus heraus, aus einem Worte, aus seinem Bilde, aus seinem Leben, aus der Kraft seines erlösenden Todes und seiner Auferstehung überzeugt sein, daß die Welt nicht ist, wie sie sichtbar scheint. Sie ist auch das, aber zugleich mehr als das. Sie ist nicht darin versiegelt, sondern durch die Erlösung ist in ihr ein neuer Anfang geschehen. Von dorther geht eine zweite Schöpfung vor sich. Der Glaube aber hat es daraufhin gewagt und hält fest, daß dieses Werden der neuen Schöpfung sich in jedem Menschen vollziehen kann, durch jedes Wort, durch jedes Geschehen. Quer durch alles hindurch vollzieht sich das Werden des neuen Menschen, der gebildet wird nach dem Bilde Christi, auf die Herrlichkeit der Kinder Gottes hin. Der Glaubende aber stellt sein lebendiges Sein diesem Werden zur Verfügung. Er nimmt es in seine Verantwortung auf. Er selbst wirkt es, zusammen mit Gott. Denn es soll sich ja nicht bloß an ihm zutragen, sondern es kann sich nur durch Freiheit verwirklichen; wohl von Gott gewirkt, aber im lebendigen Wollen und Wirken des Menschen, das heißt, in seinem Glauben.”
So sind Welt und Mensch, in die Dynamik Christi gestellt, einander zutiefst verwandt: in Ursprung, im Fall, im Erlöstsein, in der angekündigten Zukunft. Aber diese Dynamik geschieht nicht über den Kopf des Geschöpfes hinweg. Christlich formuliert: In der Begegnung gerade des erlösten Menschen mit der Welt geschieht etwas noch nicht Dagewesenes. “Die Welt ist nicht fertig. Und nicht nur deshalb, weil sie sich noch weiterentwickeln, Dieses und Jenes werden müßte. Es ist tiefer gemeint. Die Welt sind nicht die Dinge draußen für sich allein, sondern das, was in der Begegnung zwischen dem Menschen und ihnen wird. (…) Hierin besteht der Schöpferdienst, zu dem Gott den Menschen gerufen hat: daß immerfort, in seiner Begegnung mit den Dingen, die eigentliche Welt werde. ( ) Diese Welt wird immerfort; leuchtet auf und erlischt wieder.” Solches Werden ist Auftrag, Imperativ und Wille des Schöpfers, der sein Geschöpf dabei stark und schaffend sehen will. Der Mensch ist omnipotentia sub Deo, “Allmacht unter Gott”, wie Guardini zustimmend Anselm von Canterbury zitiert.
Not und Segen der Entscheidung: Der Jakobskampf
Weshalb aber hat der Schöpfer gewagt, das gefährliche Instrument freier Entscheidung seinem Geschöpf in die Hand zu geben? Guardini hat dazu 1932 eine großentworfene Deutung versucht anhand von Jakobs Kampf mit Gott. Das 32. Kapitel der Genesis eröffnet einen geheimnisvollen Zusammenhang: Jakob, geflohen vor dem betrogenen Bruder Esau, kehrt nach Jahren in die Heimat zurück, der Segen seines Vaters Isaak hat sich ausgewirkt: Frauen, Kinder, Herden zeigen sichtbar die Huld Gottes; Reichtum hat sich im Überfluss eingestellt. Esau hat den Betrug nicht vergessen und zieht ihm entgegen; Jakob bleibt am sicheren Ufer zurück, denn er fühlt den Kampf voraus. Wird der sichtbare Segen anhalten oder wird Jakob erschlagen? Anstelle des Bruders aber, dem er ausweicht, ringt plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, ein Unbekannter mit ihm – ein Engel, ein Bote? Oder Gott selbst? Zu dem Unbekannten gehört schon, dass diese Frage sich nicht schließt, auch am Ende nicht.
Der Kampf ist sonderbar: “ein dunkles Ineinander von Übermacht und Schwächersein zugleich”. Jakob siegt nach der endlosen Nacht, aber er hinkt, denn der andere hat seine Übermacht leichthin demonstriert – er brauchte Jakob nur zu berühren. Aber auch umgekehrt: Jakob hinkt, aber er siegt, denn der mächtige Unbekannte zeigt sich am Ende überwunden. Die Sonne geht auf, und Jakob trägt den neuen Namen Israel; damit trägt er eine neue Bestimmung und wird so ein zweites Mal und diesmal rechtmäßig den Bruder bezwingen, nämlich durch Versöhnung.
Jakob ist nach Guardini einer der Großen in den Stationen des Heils, ein Mann der Kraft und Schläue. Er gerät in das Geheimnis Gottes, in die schwer zu bestehende Nähe zu Gott und wird darin gezeichnet. Er ist Begründer eines königlichen und hinkenden Geschlechts, das bis zum heutigen Tage fortdauert. Kann man aber mit Gott wirklich kämpfen? Gibt es wirklich eine Entscheidung für ihn oder gegen ihn? Guardini sieht in der biblischen Überlieferung ein Doppeltes: Sie kennt Gott als den, dem nichts widersteht. Sie kennt ihn aber auch als den, der seine Übergröße zurücknehmen kann. Der Souverän kann bittend kommen – im Maß des Menschlichen, er lässt sich fragen und gibt Auskunft. In der Jakobsgeschichte ist beides verbunden: der Unwiderstehliche und der Bezwingbare. Was bedeutet es, dass er hier im Kampf kommt, dabei siegt und doch nicht siegt?
Gott will den Menschen ringen sehen
Offenbar will er, so Guardini, dass der Mensch mit ihm kämpft, ja in geheimnisvoller Weise ihn bezwingt. Hier öffnet Guardini eine wunderbare Aussage: Gott will den Menschen ringen sehen – gerade weil er ihn als sein Bild geschaffen hat. Denn das gehört zum Ebenbild: nicht als Marionette und Befehlsempfänger geschaffen zu sein, mit dem Gott leichtes Spiel hätte, sondern als Freier, Starker zu leben, zu schaffen, zu gestalten, was zum eigenen Leben dient. Hier liegt die wunderbare Herausforderung zur Entscheidung: Die Liebe will, dass man mit ihr kämpft, dass man um Klärung für sein eigenes Leben kämpft, dass man sich kämpfend mit allen Fragen auf Gott einlässt. Es ist Liebe, die den Menschen nicht als bloßes Kind will.
Natürlich gibt es das kindliche Dasein, das Gott nahesteht und dem er sich in rein vollendender Weise kundgibt. So muss man sich wohl die Kinder denken, die früh sterben: Guardini meint, dass Gott hier etwas an der Lebensleistung ergänzt oder dass ein solches Leben als reine Gabe abgepflückt wird. Aber das normale Dasein kennt nicht diese frühe Begabung und Vollendung. Die Normalität besteht im Treffen auf Widerstände, Querliegendes auch im eigenen Herzen. Die mitgegebene Natur, der Umgang mit Freunden und Gegnern will bestanden werden, und das macht einerseits müde, andererseits ruft es unentbundene Kraft heraus.
Die Geschichte Jakobs klärt auf, dass in den Widerständen – zunächst ist ja nur der Bruder und Feind Esau erwartet – ein anderer uns antritt oder anspringt: ein Geheimnisvoller, der sein Visier nicht lüftet. Und er zeigt Macht: Wollte er, so würden wir unterliegen; er zeigt aber auch Bezwingbarkeit: Wollen wir, so können wir eine ganze Nacht lang kämpfen und ihn um Segen bitten. Dieses Ineinander von Herausforderung und Segen, von Widerstand und Sieg, von Nacht und schließlichem Sonnenaufgang ist eine Botschaft vom Wesen Gottes und Wesen des Erwählten. Was als Widerstand und scheinbare Zerstörung kommt, kommt – wenn der gute Kampf gekämpft ist – als Segen. Gottes Macht kommt nicht zerbrechend. Sie fordert ein Äußerstes an Kraft, aber sie überwältigt nicht. In der Gestalt des Widerstandes will sie als Liebe erfasst werden.
Gott will im Glauben Freie, keine Befehlsempfänger
Dies als Ermutigung für die kommenden Generationen, in der Nacht des Kampfes wie Jakob auszuhalten, bis die Sonne aufgeht. Es ist ja alles erkämpft, im Ringen gegen ihn, mit ihm. Gerade so fordert er den Menschen heraus zur “Annahme seiner selbst”, zum Wachsen zur Größe, zum Ringen mit seinem Ursprung. Dass der Mensch nicht zu einem Automatismus verurteilt ist, sondern sich entscheiden, zur eigenen Kraft greifen kann, sieht Guardini als eine der gewaltigsten unter den großen Gaben des Ebenbildes.
Das scheint die Mitte von Guardinis Denken zu treffen: sein eschatologischer Blick auf das gegenseitige Ringen von Gott und Mensch. Aufbrechen aus dem Dunkel der Sünde heißt, sich in die Herausforderung Christi zu stellen, auf Ihn hin neuwerden zu wollen. Mit aller Kraft – denn es gehört zur Größe der Gnade, dass sie unsere Mitwirkung wünscht. Im dritten Neuwerden der Schöpfung am Ende der Zeit werden diese noch undurchschauten Zusammenhänge endlich geöffnet. “Gott muß uns unbekannt sein. Doch gerade seine Unbekanntheit geht uns an. Sie ist das Kostbarste. Sie verheißt uns Heimat. Unsere Seele wittert im Unbekannten das Eigentliche, woraus sie lebt, und den Ort, wo sie hingehört.”
Romano Guardini (1885-1968) war ein deutsch-italienischer Theologe, Philosoph und Priester, der als einer der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts gilt. 1910 zum Priester geweiht, spielte Guardini eine zentrale Rolle bei der Erneuerung der Liturgie: Sein Werk „Vom Geist der Liturgie” (1918) hatte großen Einfluss auf das Zweite Vatikanische Konzil. Zudem beschäftigte er sich (auch im Dialog mit Denkern wie Sokrates, Dostojewski und Kierkegaard) mit dem Wesen des Menschen und dem Verhältnis des Christen zur modernen Welt gleichzeitig brachte er Zeitgenossen in zahlreichen Büchern und Schriften den christlichen Glauben nahe. Guardinis Denken und Werk, wie zum Beispiel das Christus-Buch “Der Herr” (1937), beeinflusste unter anderem den jungen Joseph Ratzinger.
Katholischen Journalismus stärken
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Stärken Sie katholischen Journalismus!
Unterstützen Sie die Tagespost Stiftung mit Ihrer Spende.
Spenden Sie direkt. Einfach den Spendenbutton anklicken und Ihre Spendenoption auswählen:
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.
Themen & Autoren
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Bibel
Gottesbild
Jesus Christus
Romano Guardini
Schöpfung



Schreibe einen Kommentar