Kreuzigung einer katholischen App *UPDATE
Hallow – Antichristliche Berichterstattung liegt im Trend. Ein Tiefpunkt war der Umgang auch öffentlich-rechtlicher Medien mit der katholischen App “Hallow”. Eine Fallstudie – Semper aliquid haeret… – ‘Irgendwas bleibt immer hängen’
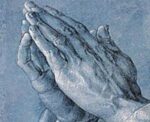 Quelle
Quelle
Hallow – Die Nummer 1 der katholischen Meditations-, Gebets- und Schlaf-Apps
Mehr als beten? J.D. Vance und Peter Thiel fördern App “Hallow” | BR24
Heiligenkreuzer Mönche in Gebets-App “Hallow” vertreten
Jim Caviezel
*Gebetsapp Hallow: Erfolgsgeschichte voller Begegnungen mit Gott – Vatican News
21.06.2025
Na wenn das nicht mal eine launige Abmoderation ist: “‘This shit is bananas’, kann sich jeder selbst übersetzen”, so endet ein etwa fünfminütiger Radiobeitrag des Deutschlandfunks über die erfolgreiche katholische Gebetsapp “Hallow”. In deutschen Leitmedien, öffentlich wie privat, schlug der App, nachdem eine Werbekampagne zur Fastenzeit für erhöhte Aufmerksamkeit gesorgt hatte, rund um Ostern teils offener Hass entgegen – wie das aus einer Liedzeile der mittlerweile “Hallow” bewerbenden Popsängerin Gwen Stefani entlehnte Zitat beweist: ein buchstäblicher Shitstorm. Die Vorwürfe, die dazu aufgebaut wurden, sind, wie auch in ähnlich gelagerten Fällen antichristlich gefärbter Berichterstattung, größtenteils hanebüchen. Die Beschuldigten wurden nicht befragt. Und wenn die daraus entstehenden inhaltlichen Kurzschlüsse hinterfragt werden, reagieren die Verantwortlichen nicht nur verständnisvoll.
Die kleine Geschichte über Medien in postchristlichen Zeiten, die hier erzählt werden soll, erfüllt im Übrigen ebenfalls nicht ganz die Kriterien neutraler Berichterstattung. Da wäre einerseits eine grundsätzlich prochristliche Voreingenommenheit. Und andererseits ein gewisser Interessenskonflikt. Mit der Gebets-App Hallow – “dieser Scheiße”, wie der Deutschlandfunk sagen würde –, und ihren Betreibern, verbindet die “Tagespost” eine Marketingkooperation. Wer darin ein Problem erkennt, möge sich daher parallel gern auch in säkularen Medien über die App informieren – und dann selbst entscheiden, ob der hier präsentierte Einspruch valide erscheint.
I. Was Hallow vorgeworfen wurde – und wie
“Hallow”, zu deutsch etwa “heilig”, ist eine Smartphone-App, die mit kurzen angeleiteten Gebeten oder Meditationen zum Anhören das geistliche Leben erleichtern will. Ein Versuch, mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts Herzen und Seelen zu Gott zu erheben – mit täglichen Gebetserinnerungen, Lesungen, geistlichen Inputs, einem digitalen geistlichen Tagebuch und “Challenges”, bei denen eine digitale Gebetsgemeinschaft gemeinsam betet. Was aber auch nur heißt, dass etwa “256.000 am beten” auf dem Bildschirm steht, während die Audioeinheit abgespielt wird. Bei alldem ist “Hallow” sowohl gut katholisch als auch sehr erfolgreich – in den Vereinigten Staaten stand die App kurzzeitig sogar auf Platz 1 der meistheruntergeladenen Apps im Apple Appstore. In Deutschland sind solche Platzierungen nicht zu erreichen, stattdessen heißt es momentan Platz 69 in der Kategorie “Nachschlagewerke”. Über mangelnde Unterstützung aus der Szene kann man sich dafür nicht beklagen, deutsche Einheiten werden etwa von Gebetshausgründer Johannes Hartl oder der (evangelischen) Influencerin Jana Highholder gesprochen.
Was erregt nun den Abscheu deutscher Journalisten? In keinem Bericht darf der Hinweis fehlen, dass US-Vizepräsident J.D. Vance und der Techinvestor und Trump-Unterstützer Peter Thiel vor Jahren in die App investierten. Schon das reicht der FAZ, einen ersten Pflock einzuschlagen: “Vance und Thiel haben gemeinsam, dass sie das Potential der religiösen Rechten für ihre Ziele früh erkannt haben.” Merke: um die Unterstützung einer religiösen Initiative oder ein gutes Investment als Selbstzweck kann es ja wohl nicht gehen. Die Überschrift des Stücks lautet denn auch passend “Es geht gar nicht um Gott, oder?” Damit aber nicht genug: man biete “Extremisten eine Plattform”, einziges Beispiel: auch der Schauspieler Jim Caviezel, bekannt als Jesus in Mel Gibsons “Passion”, trete in Videos in der App auf. Tatsächlich gibt es etwa eine Gebetseinheit, in der Caviezel für die Opfer von Kinderhandel betet, und dabei auch für sein als verschwörungstheoretisch geltendes Kinderhandel-Dokudrama “Sound of Freedom” wirbt.
Konkreter wird es bei der FAZ nicht mehr, dennoch reicht der Befund für die Diagnose “christlicher Nationalismus”. Explizit politische Botschaften fänden sich zwar nicht, aber “auf den zweiten Blick” könnten ja hinter den religiösen Botschaften auch “politische Hass-Codes” stecken, “zum Beispiel dort, wo sich die christliche Losung ‘Christ is King’ in der MAGA-Szene zu einer Parole gewandelt hat, die auch als Antisemitismus-Code dienen kann.” Belege, dass “Christus ist König” in einer katholischen App antisemitisch gemeint sein soll, liefert die Autorin natürlich nicht, referiert stattdessen über US-Neonazi Richard Spencer, der mit dem Christentum nun wirklich gar nichts am Hut hat, um schließlich zu bemerken, alte Fans von Prominenten wie der eingangs genannten Stefani ärgerten sich “über die Verbindung ihrer Idole zu diesem Milieu”.
Nur minimal weniger fantasievoll geht es in der Spiegel-Geschichte zum gleichen Thema zu. Da heißt es dann in bester Kontaktschuld-Denunziationsmanier: “Googelt man kurz, welche Personalien sich hinter den äußerst knappen Sprecher- und Sprecherinnenbeschreibungen verbergen, wirkt nichts mehr entspannend. Da ist etwa Bischof Robert Barron, der auf seinem YouTube-Kanal Menschen wie den ultrarechten Journalisten Ben Shapiro und den Maskulinisten-Posterboy Jordan Peterson empfängt.” Chosen-Darsteller Jonathan Roumie, sei – schlimm, schlimm – bereits bei Antiabtreibungsmärschen als Redner aufgetreten. Als ehemaliges (!) Werbegesicht sei der britische “Komiker und Verschwörungserzähler” Russell Brand aufgetreten, gegen den wegen des Verdachts auf Vergewaltigung ermittelt werde. Darauf folgt die in vielfacher Hinsicht ziemlich irre Einordnung: “Die App-Betreiber scheinen sich an Brands möglichen Sünden, die er bestreitet, nicht zu stören. Das passt zur Haltung der religiösen Rechten in den USA, ein Mensch müsse nicht selbst nach Gottes Gesetzen leben, um zu seinem Werkzeug zu werden, womit sie für sich auch Trump als von Gott auserwählte Erlöserfigur plausibilisieren.” Im Zweifel für den Angeklagten? Gar Vergebung der Sünden? Von diesen Prinzipien scheint die Spiegel-Autorin, die sich selbst einen kindheitsbedingten, auch von ihrem erwachsen-aufgeklärten ich “wohl nie ganz ausrottbaren katholischen Schuldgefühlkomplex” attestiert, noch nie etwas gehört zu haben. Ganz zu schweigen davon, dass die Zusammenarbeit mit Brand ja gerade deshalb beendet wurde.
Substanzieller sind Fragezeichen beim Thema Datenschutz. Auch hier entstammen die Informationen der meisten deutschen Beiträge allerdings nicht etwa eigener Recherche, sondern beziehen sich auf einen Buzzfeed-Bericht aus dem Jahr 2022. In diesem wurde darauf hingewiesen, dass die Datenschutzbestimmungen von Hallow die Weitergabe von Nutzerdaten an Regierungen, Strafverfolgungsbehörden und andere “private Parteien” ermöglichten. Und bei anderen religiösen Apps sei teils unklar, wie die Daten verwendet würden. Eine (“Instapray”) sei immerhin an ein politisch konservatives Medienkonglomerat verkauft worden. Allerdings, so Buzzfeed schon 2022, hätte Hallow mitgeteilt, dass Informationen über die Nutzer nicht mit Regierungen, Behörden oder Dritten geteilt worden wären – trotz der damals noch rechtlich bestehenden Möglichkeit.
Wieder ist die Aufbereitung im Deutschlandfunk besonders wild. Aus der über drei Jahre alten Buzzfeed-Recherche und dem Fakt, dass es den Republikanern bei der Präsidentschaftswahl gelang, den “Catholic Vote”, also die Mehrheit der katholischen Wähler für sich zu gewinnen, wird die folgende Verschwörungstheorie: Um die bisher eher demokratisch wählenden Katholiken in den “Swing States” von Trump zu überzeugen, “brauchte es also etwas, das die Hallow-App für Menschen wie Peter Thiel so wertvoll macht: Spezifische Daten, die Rückschlüsse auf den sogenannten Catholic Vote zulassen könnten.” Die “Sicherheitslücken” habe Hallow inzwischen behoben, schiebt der Bericht nach. Doch die Unterstellung, Hallow-Daten wären via Thiel politisch ausgeschlachtet worden, um katholische Wähler zu gewinnen – eine Theorie, für die selbstverständlich jeglicher Beleg fehlt – bleibt stehen. Dass die entsprechende Überarbeitung der Datenschutzbestimmungen noch 2022, also lange vor der Wahl durchgeführt wurde, wird passenderweise nicht erwähnt.
Während FAZ und Spiegel bei diesen doch harten Vorwürfen zu vorsichtigeren Formulierungen greifen, und sich lieber in blumigen, aber wenig angreifbaren Assoziationsketten verlieren, geht auch der Bayerische Rundfunk erstmal in die Vollen. So hieß es in einem mit “Datensammeln für den Wahlkampf?” betitelten Bericht auf der BR24-Website: “Benutzerdaten wurden nicht nur zu Werbezwecken an Geschäftspartner weitergegeben, sondern auch für gezielte, interessens- und verhaltensbasierte Werbung verwendet. Die Lücken sind inzwischen geschlossen, der US-Wahlkampf längst gewonnen, die Wahlberichterstattung auf dem rechten Sender Fox News wurde von der App gesponsert.” Eine durch und durch manipulative Aufzählung: zwar wird nicht direkt behauptet, die Hallow-Daten hätten den Ausgang der Wahl entschieden, vielmehr stehen hier einfach Aspekte nebeneinander. Als Subtext blieb aber hängen: jetzt, wo die Wahl für die Republikaner mit freundlicher Hilfe der Hallow-App “längst” gewonnen wurde, wurden auch die Datenschutz-Vorschriften aktualisiert. Was natürlich schlicht falsch ist.
II. Was Hallow zu den Vorwürfen sagt – wenn man denn fragt
Journalismus soll kritisch sein, insofern ist die Äußerung auch hochspekulativer Theorien nicht immer gleich ein Kunstfehler. Was aber gerade bei dem zu unparteischer Berichterstattung angehaltenen öffentlich-rechtlichen Rundfunk erstaunen sollte, ist, dass weder Deutschlandfunk den Beschuldigten, also Hallow, um eine Stellungnahme gebeten haben. Dabei ist Hallow zwar ein Start-Up ohne große Medienabteilung, aber auch keine Briefkastenfirma, die nicht auf Anfragen reagieren würde.
So hat sich gegenüber dieser Zeitung Co-Gründer Alessandro DiSanto zu den Vorwürfen geäußert. Tatsächlich habe man anfangs eine branchenübliche Datenschutzerklärung verwendet, die “nach Lesart einiger Beobachter den Verkauf von Nutzerdaten hätte erlauben können” – was man aber nie getan habe. Nach erster Kritik habe Hallow die Formulierungen upgedated, so dass aus diesen seit 2022 der “langjährige Ansatz, niemals Nutzerdaten an Dritte weiterzugeben oder zu verkaufen, natürlich auch nicht an Regierungsbehörden oder Investoren” auch klar hervorgehe.
“Unsere oberste Priorität ist es, Menschen zu helfen, in den Himmel zu kommen”, sagt DiSanto im Gespräch mit der Tagespost. “Und unsere zweithöchste ist es, ihre Daten zu beschützen”. Hallows Ansatz bestehe generell darin, Daten zu anonymisieren und lediglich ein Minimum zu nutzen, um die Nutzererfahrung zu personalisieren und optimieren. Persönliche Notizen und geistliche Tagebücher etwa seien verschlüsselt und würden nur auf dem Endgerät selbst gespeichert. Einige Nutzerdaten würden von vertrauenswürdigen Service-, Analyse- und Werbepartnern genutzt, um die Funktionalität und Reichweite zu gewährleisten, nie jedoch zum Weiterverkauf. Dabei seien Servicepartner etwa solche, die Datenspeicher zur Verfügung stellten oder Zahlungen verarbeiteten. Analysepartner wiederum würden aggregierte Daten zum Nutzerverhalten aufzeichnen – etwa, wie viele Nutzer gerade bei einer Gebets-“Challenge” mitbeten würden. Werbepartner schließlich stellten Marketing-Dienstleistungen bereit, erhielten von Hallow aber nur begrenzt Daten, wobei persönliche Daten wie Emailadressen sicher mittels sogenanntem “Hashing” verschlüsselt würden. Bereits 2022 habe Hallow so eine “SOC 2 Typ II”-Akkreditierung erhalten, eine Art unabhängige Datensicherheits-Zertifizierung.
Bleibt freilich die Frage nach der grundsätzlichen politischen Neutralität der Marketing- und Investorenstrategie. Tatsächlich wurde Hallow im Vorfeld der Präsidentschaftswahl etwa in einer Talkshow des Republikaner-nahen Senders Fox News vom heutigen Verteidigungsminister und damaligen Moderator Pete Hegseth in Form eines Live-Gebets beworben. Wieso? “Wenn jemand uns die Gelegenheit gibt, Menschen in eine Beziehung mit Christus einzuladen, nehmen wir sie an”, sagt DiSanto, der dabei auf “kompletter Unabhängigkeit von politischen oder ideologischen Agenden” beharrt. Tatsächlich sei die App auf einem weiten Spektrum unterschiedlicher Medien beworben worden, um so viele Menschen wie möglich mit der Botschaft des Glaubens zu erreichen. So sei Hallow im Programm von Fox News aufgetaucht, aber auch bei progressiveren Sendern wie MSNBC. Da es das Ziel von Hallow sei, möglichst Jeden zu erreichen, habe man sich aktiv um Partnerschaften quer durch die Medienlandschaft bemüht.
Ebensowenig habe Hallow Investoren nach politischen Kriterien ausgesucht. Auch “Narya Capital” sei ein Fonds, der “in unsere Serie B investiert hat und der einer von hunderten verschiedenen Investoren” sei. “Damals war J.D. Vance Partner der Fondsgesellschaft, er trat wenig später zugunsten seiner Kandidatur für den US-Senat zurück. Wir haben nie mit ihm selbst zusammengearbeitet. Wir haben während des gesamten Prozesses und danach mit einem anderen Partner des Fonds gearbeitet”, sagt die DiSanto.
Schließlich: “Extremist” (FAZ) Jim Caviezel. Wieso wurde ihm eine Gebetseinheit als Plattform gegeben, die er dann nutzte, um einleitend für seinen Film zu werben? “Jim Caviezels Stimme ist Zuhörern auf der ganzen Welt bekannt, weil er Jesus in Mel Gibsons ‘Die Passion Christi’ gespielt hat”, ist DiSanto sicher. “The Sound of Freedom”, einer seiner letzten Filme, sei eine dramatische Geschichte über Kinderhandel. Man sei den Opfern von Menschenhandel auf der ganzen Welt solidarisch verbunden, und habe “Jim eingeladen, Gebete zu lesen, die wir für diese Opfer, die der Kirche wirklich am Herzen liegen, geschrieben haben”. Man arbeite mit verschiedensten Menschen, aber “das Ziel ist nie, einem Gebetsleiter eine politische Plattform zu bieten, die unweigerlich zu Spaltung führe – sondern eine Möglichkeit der Gottesbegegnung zu schaffen, die eint.”
III. Wie Medien reagieren, wenn man Sie auf die ideologische Schlagseite in ihrer Berichterstattung hinweist
Politische Hypersensibilität nach dem Geschmack deutscher Medien kann man Hallow sicherlich nicht vorwerfen, eher schon eine grundgute Naivität hinsichtlich der Möglichkeit, in politisch vergiftetem Umfeld überhaupt Neutralität wahren zu können. Zusammenarbeit mit dem ein oder anderen nicht 100 Prozent politisch sterilen Akteur, mit Menschen, die vielleicht sogar mal falsch liegen, das wollen die Hallow-Macher – und das wäre nebenbei bemerkt auch kein christliches Anliegen – offenbar nicht ausschließen. All das öffnet zweifellos politische Flanken für pharisäisch gesinnte Berichterstattung, rechtfertigt aber nicht Beiträge, die ohne jeden Beweis handfeste Verschwörungserzählungen transportieren. Oder doch?
Bei der FAZ, deren virtuoses Assoziationskonglomerat immerhin relativ unschwer als ebensolches erkannt werden kann, mauert man auf Anfrage, ob man bei Hallow um Stellungnahme gebeten habe. Zu “internen Abläufen und Recherchewegen” gebe man “grundsätzlich keine Auskunft”. Anders gehen hingegen die per Medienstaatsvertrag zu sachlicher und wahrheitsgemäßer Berichterstattung verpflichteten Öffentlich-Rechtlichen vor; man beschäftigt sich mit den Vorwürfen jedoch auf ganz unterschiedliche Weise.
So schreibt der Bayerische Rundfunk, man habe die Anfrage “zum Anlass genommen, den Text an einzelnen Stellen zu präzisieren, und dies auch qua Transparenzhinweis kenntlich gemacht.” Tatsächlich bleibt von den Vorwürfen hier nicht mehr allzu viel übrig. Der Beitrag heißt nun nicht mehr “Datensammeln für den Wahlkampf”, sondern deutlich defensiver “Mehr als beten? J.D. Vance und Peter Thiel fördern ‘Hallow'”; der oben zitierte Hinweis auf den längst gewonnenen US-Wahlkampf verschwindet genauso wie die Behauptung, Benutzerdaten seien zu Werbezwecken weitergegeben worden; ebenso verschwindet lustigerweise hinter der Information, der “rechte Ex-Fox-News-Moderator Tucker Carlson” vermute, die App könne die Welt “grundlegender verändern als jeder Politiker” der darauffolgende einordnende Halbsatz “womit er vielleicht nicht Unrecht hat, möglicherweise allerdings nicht zum Guten”. Interessant auch die Erklärung BR-Pressesprecherin, bei dem Text handele es sich “um einen Artikel, der ein Thema nachrichtlich zusammenfasst, über das seit 2022 bereits hinlänglich von etlichen Medien berichtet wurde“ – was wohl heißen soll, Stellungnahmen von Hallow anzufordern, sei nicht notwendig. Das kann man selbstverständlich so sehen, auch die Berichterstattung dieser Zeitung stützt sich immer wieder auf Informationen anderer Medien, allerdings gab der BR Information aus dem Buzzfeed-Stück sachlich falsch wieder – neben genauerer Lektüre hätte sicher auch eine eigene Anfrage geholfen. Zudem war sich die Redaktion auch nicht zu schade, Gebetshausgründer Johannes Hartl zu seinem Engagement bei Hallow anzufragen und die Stellungnahme einer Wiener Medienethikerin einzuholen.
Deutschlandradio hingegen, die Anstalt, die den “Deutschlandfunk” produziert, antwortet auf die Frage dieser Zeitung, wie es zu der mindestens impliziten Vorhaltung, dass der “Catholic Vote” nur mithilfe von Hallow-Daten gewonnen werden konnte, kam: “Der von Ihnen genannte Satz enthält weder einen Vorwurf noch eine ‘implizite Vorhaltung’. Wie der Konjunktiv ‘könnte’ ausdrückt, bestand die Möglichkeit, dass eine Datenauswertung der App Rückschlüsse auf den ‘Catholic Vote’ zulässt. Dass der ‘Catholic Vote’ nur mithilfe solcher Daten gewonnen werden konnte, wird nicht behauptet.” Dazu die Aussage im Radiobeitrag nochmal in voller Länge: “Dennoch haben die Katholiken in den Swing States, größtenteils Nachfahren von italienischen, polnischen und irischen ArbeiterInnen und Latinos traditionell eher demokratisch gewählt. Um sie im Wahlkampf für Trump zu gewinnen, brauchte es also etwas, was die Hallow-App für Menschen wie Peter Thiel so wertvoll macht: Spezifische Daten, die Rückschlüsse auf den sogenannten Catholic Vote zulassen könnten.” Möge ein jeder selbst entscheiden, welcher Eindruck entsteht. Nur noch eine Randnotiz: Im Rahmen der journalistischen Sorgfaltspflicht sei es, so der Deutschlandfunk, “nicht notwendig, das ‘Hallow-Team’ mit einer unserer Aussagen zu konfrontieren.”
Letzten Endes ist die Berichterstattung über Hallow ein Lehrstück darüber, wie Medien funktionieren, und darüber hinaus eine exemplarische Illustration “sprungbereiter Feindseligkeit” gegenüber christlichen Inhalten, wie sie – Beispiele dafür gab es zuletzt praktisch im Wochentakt – das progressive Milieu, aus dem sich Journalisten meist rekrutieren, zunehmend auszeichnet.
Dabei sind die Mechanismen zunächst einmal menschlich: Über einige Wochen macht ein exotisches Thema die Runde, also meint jede Redaktion, die auf sich hält, ein Stück dazu zu benötigen. So kommt es zu sich gegenseitig bestätigenden Berichten, die Recherche auch nicht mehr wirklich nötig haben, da die Grundinformation ja schon zum vielfach berichteten Allgemeinplatz geworden ist. Da erstaunt es dann auch nicht, wenn zwar jeder Beitrag auf den selben drei Jahre alten Artikel abhebt, man aber dem ein oder anderen Stück durchaus anmerkt, dass dieser gar nicht gelesen wurde – ganz offensichtlich hat man stattdessen weitere, auf ebenjenen Artikel bezugnehmende Tendenzstücke deutscher Medien gelesen, und die dort verbreitete Meinung für bare, zitierfähige Information gehalten.
Hinzu kommt Voreingenommenheit. Engagement gegen Abtreibung oder Pornographie? Völlig selbstverständliche Teile christlicher Ethik werden, wohl auch mangels Kenntnis, als dezidiert rechtes politisches Statement interpretiert. Und da man zudem Kontakte mit dem für die deutsche Medienszene absolut Bösen, der Trump-Regierung, aufzeigen kann, ist die Marschrichtung für alle sowieso klar. Da darf dann auch gern alles in einen Topf geworfen werden. So kommt ein “Experte” im Deutschlandfunk zu dem Schluss, dass hier eine “Entmächtigung des Volkes” vonstattengeht, die “nur mit einer parallelen religiösen Absicherung” zu gehen scheine, und bei der die “Idee von weißer Vorherrschaft (…) irgendwie verbunden mit einer sehr traditionalistischen Interpretation des katholischen Christentums” ist, während die FAZ von Antisemiten und “Tradwifes” schwadroniert. Kann man schon alles machen, ist teils auch gruselig-anregend wie ein guter True-Crime Podcast. Nur journalistisch ist das halt, um es mit Gwen Stefani zu sagen, eher “banane”.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.
Themen & Autoren
Jakob Ranke
Evangelische Kirche
J. D. Vance
Jesus Christus
Johannes Hartl
Jordan Peterson
Katholikinnen und Katholiken
Mel Gibson
Robert Barron
Tucker Carlson


Schreibe einen Kommentar