Fides et Ratio – Warum hat der Mensch Würde?
Es ist befremdlich, wenn ausgerechnet katholische Theologen bei der Frage, warum die Menschenwürde existiert, partout auf die christliche Begründung verzichten wollen
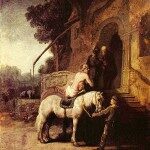 Warum hat der Mensch Würde? | Die Tagespost
Warum hat der Mensch Würde? | Die Tagespost
Menschenwürde
Theologie (52)
01.02.2025
Engelbert Recktenwald
Dass Menschen eine Würde haben, die moralische Achtung gebietet, ist eine Erkenntnis, die zu besitzen wir jedem Menschen unterstellen, den wir für moralisch zurechnungsfähig halten – unabhängig davon, ob er Christ, Atheist oder Kantianer ist. Worin gründet diese Würde? Darüber kann man streiten, ohne die Würde selbst in Frage zu stellen.
Die christliche Antwort ist eindeutig
Die christliche Antwort lautet, dass dem Menschen Würde zukommt, weil er als Bild Gottes Repräsentant des Absoluten und Teilhaber an dessen absoluter Würde ist. Es hat nichts Befremdliches an sich, wenn Atheisten diese Begründung ablehnen und verzweifelt nach einer anderen suchen. Seit Nietzsche und Darwin ist diese Suche gar nicht so einfach. Befremdlicher hingegen wirkt, wenn katholische Theologen die christliche Begründung nicht nur nicht akzeptieren, sondern sie aus vorgeblich kantischer Warte sogar für eine kulturrelativistische Verkürzung halten. Sie verstehen nicht, dass die Gründung der menschlichen Würde in Gott als dem absoluten Grund allen Seins und Sollens nicht zu ihrer Relativierung führt, sondern zur Sicherstellung ihres absoluten, unbedingten Charakters. Ihr Fehlschluss beruht auf einer Verwechslung: Die Bedingtheit des Erkennens macht die Unbedingtheit des Erkannten nicht zunichte. Jede Erkenntnis, auch die kantische, ist als kontingenter Erkenntnisakt empirisch bedingt – auch die Erkenntnis unbedingter Würde. Jede Erkenntnis kulturunabhängiger Würde ist kulturell situiert.
Dass man, um die christliche Begründung zu akzeptieren, mit dem Glauben an Gott Ernst machen muss, spricht so wenig gegen sie wie die Tatsache, dass man, um die kantische Begründung zu akzeptieren, mit dem Glauben an die Autorität der Vernunft Ernst machen muss. Für Kant ist die Vernunft der Gott in uns, und er hielt ihre Autorität für so fraglos göttlich, dass er ihr zubilligte, wie eine “himmlische Stimme” Gesetze zu geben nach dem Motto: “sic volo, sic jubeo2, also ohne weitere Begründungspflichten etwa durch Verweis auf Werte und Handlungszwecke.
Das Zeitalter des Vernunftglaubens ist längst vorbei und hat einer Vernunftskepsis Platz gemacht, die im Namen der Nicht-Vernunft, zum Beispiel des Lebens, der Triebe oder des Wahnsinns, gegen die “Disziplin der Vernunft” rebelliert. Das sind die Herausforderungen der heutigen Zeit, die nicht zu verschlafen auch ausgewiesenen Kantkennern gut ansteht.
Wenn Theologen nicht mehr theologisch argumentieren wollen
Es zeugt von Anachronismus, die Zukunft des Christentums von Stellungnahmen zur kantischen Religionskritik abhängig zu sehen, und von eigenartigem Stil, Bischöfe und Theologen, die der Bitte zu solchen Stellungnahmen für ein einschlägiges Buchprojekt nicht entsprachen, namentlich bloßzustellen, sie der “Drückebergerei” zu verdächtigen und ihnen ein “intellektuelles Armutszeugnis der besonderen Art” auszustellen. Auf die prekäre Situation, in die die kantische Vernunft durch das Werk des Alleszermalmers selbst gebracht worden ist, antworten problemsensible Denker eher in vornehmer Bescheidenheit mit einem “Bewusstsein von dem, was fehlt”. Hier liegt der Kairos zeitgenössischer Theologie.
Katholischen Journalismus stärken
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Stärken Sie katholischen Journalismus!
Unterstützen Sie die Tagespost Stiftung mit Ihrer Spende.
Spenden Sie direkt. Einfach den Spendenbutton anklicken und Ihre Spendenoption auswählen:
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.
Themen & Autoren
Engelbert Recktenwald
Charles Robert Darwin
Friedrich Nietzsche
Immanuel Kant
Katholische Theologen
Würde



Schreibe einen Kommentar