Diese Freunde können gefährlicher sein als viele Feinde
Transatlantisches Verhältnis – Welche Werte verteidigen wir eigentlich? Diese Frage muss sich der Westen stellen. Dennoch weist die Münchner Rede des US-Vizepräsidenten Vance verheerende formallogische und materielle Schwächen auf
19.02.2025
Michael Hochgeschwender
Die Rede des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance auf der Münchener Sicherheitskonferenz hat hohe Wellen geschlagen. Während Trump-Anhänger in den USA und Westeuropa sie teilweise als intellektuelle Meisterleistung bejubelten, stieß sie bei der Mehrheit der anwesenden Sicherheitspolitiker auf Skepsis, ja auf entschiedene Ablehnung.
Beide Reaktionen dürften übertrieben sein, denn dort, wo sich Vance tatsächlich auf das Thema der Sicherheitskonferenz, nämlich Sicherheitspolitik, einließ, hatte er überwiegend recht. Es ist seit Jahren, mindestens seit dem russischen Angriff auf die Krim von 2014, unbestritten, von Europa einen höheren Beitrag zur Verteidigung westlicher Interessen und Werte zu verlangen. Einige europäische Nationalstaaten, darunter die baltischen Länder, Schweden und Großbritannien, aber auch Griechenland, wenngleich unter türkischem Druck, haben daraus auch bereits Konsequenzen gezogen. Demgegenüber verharrte insbesondere Deutschland in träger Passivität, die in keiner Weise mit dem westdeutschen Engagement zu Zeiten des Kalten Kriegs vergleichbar ist.
Wo Vance einen Punkt hat
Und wenn man schon von der Verteidigung des Westens, seiner Interessen und Werte spricht, macht es durchaus Sinn, sich selbstkritisch die Fragen zu stellen, welche Werte man denn da eigentlich verteidigt und wie es mit dem eigenen Umgang mit diesen Werten denn bestellt ist. Und die Meinungsfreiheit zählt ohne Frage zu den zentralen, nicht hintergehbaren Werten, die für “den Westen” konstitutiv sind.
Wieder hatte Vance hier einen Punkt: Inwieweit hat möglicherweise eine unkontrollierte, weltanschaulich bedingte Regulierungswut nationaler und europäischer Behörden den Korridor des Sagbaren in einer unangemessenen Weise eingeschränkt? Wo genau liegen die Grenzen zwischen einer vollkommen legitimen Meinungsäußerung und einer unter Umständen justiziablen Beleidigung. Die USA haben sich hier traditionell für eine sehr weite Auslegung der im ersten Zusatzartikel der Verfassung garantierten Meinungsfreiheit entschieden. Es sei nur an die schwarze Bürgerrechtlerin Eleanor Norton Holmes erinnert, die in den 1970er Jahren unablässig für das Recht des rassistischen Ku-Klux-Klan kämpfte, seine Positionen in aller Öffentlichkeit solange zu vertreten, wie das Strafrecht nicht berührt war. Man stelle sich ein vergleichbares Verhalten einer dezidiert linken Aktivistin zugunsten der AfD oder anderer rechtsextremer Parteien und Organisationen in Deutschland einmal kurz vor.
Aber just an diesem Punkt setzen die mitunter verheerenden formallogischen und materiellen Schwächen der Rede des Vizepräsidenten ein. Das Verhältnis von Meinungsfreiheit und Strafbarkeit muss permanent sowohl politisch wie gesellschaftlich und juristisch neu ausverhandelt werden – und da gelten jeweils nationale Besonderheiten. Schweden etwa ist jahrzehntelang durch die semikollektivistische folkhem-Ideologie geprägt worden und hat traditionell ein anderes Verständnis des Verhältnisses von individueller Freiheit und kollektiver Verantwortung als die vom Altliberalismus geprägten USA.
Historische Fakten kann man nicht als irrelevant abtun
In Deutschland wiederum wirken die Verbrechen der Nationalsozialisten im kollektiven Gedächtnis nach und wirken sich auf die nationale Rechtskultur aus. Der britische Fall liegt wieder etwas anders. Traditionell waren die Briten im Umgang mit von der Mehrheit abweichenden Meinungen weitaus toleranter als die USA. Nicht umsonst flohen viele Verfolgte der McCarthy-Ära in den USA in den 1940er und 1950er Jahren in das Vereinigte Königreich. Aber gerade dort hat sich in den vergangenen Jahren eine besonders rigide Variante politischer Korrektheit durchgesetzt, die viel mit der kolonialen Vergangenheit des Landes zu tun hat, was sie aber nicht jeder kritischen Analyse entheben sollte.
Vor allem aber lässt Vance jeglichen Kontext vermissen, sei es in den Einzelbeispielen, die er anführt, sei es auf der allgemeinen Ebene. Bei aller Notwendigkeit zur kritischen Selbstreflexion: In Russland, das einen offenen, völkerrechtswidrigen Angriffs- und Expansionskrieg gegen die Ukraine führt, der neuerdings Präsident Trump die Schuld an der Dauer des Kriegs aufbürden will, werden Oppositionelle eingesperrt und sogar ermordet. Warum spielte das so gar keine Rolle in der bemerkenswert einseitigen Rede?
In den USA entlässt die aktuelle Administration ohne Einzelfallüberprüfung Staatsbedienstete, darunter Personal, das für die nationale Sicherheit relevant ist, einzig weil sie im Verdacht stehen, der Vorgängerregierung dienstlich zugearbeitet zu haben und gefährdet dadurch die nationale Sicherheit. Die Trump-Administration und republikanische Einzelstaatsregierungen führen einen offenen Kampf gegen eine kritische Geschichtswissenschaft, welche sich auch der Schattenseiten der US-Geschichte annimmt und durch Quellen gut belegt, dass die rosarote Selbstsicht auf die eigene Nation, wie sie von Trump, Vance und ihren Gefolgsleuten propagiert wird, nicht tragbar ist. Sklaverei und Genozid an den Indianern waren Bestandteile eben dieser Geschichte. Dagegen kann man nicht einfach den Glauben setzen, das alles stimme nicht oder es sei wenigstens irrelevant.
Vance hat die diskursive Hegemonie errungen
Inzwischen regelt die Administration sogar, welche Begrifflichkeiten Wissenschaftler in Anträgen und Publikationen noch benutzen dürfen, wenn sie Regierungsgelder erhalten. Selbst Mediziner, Physiker und andere Naturwissenschaftler sind von diesen obskuren Vorgaben betroffen. Geht es hier oder im Fall der sogenannten Critical Race Theory, der man gewiss große Skepsis entgegenbringen kann, etwa nicht um freie Meinungsäußerung? Seit wann ist es mit dem amerikanischen Verständnis von Meinungsfreiheit vereinbar, akademische Debatten durch regierungsamtliche Dekrete lenken zu wollen? Vor wem eigentlich fürchtet sich die amerikanische Regierung? Vor Wissenschaftlern, “dem Volk” oder gar – der Wahrheit? Warum sollten unflätigste Beschimpfungen im Internet und die Verbreitung offensichtlicher Lügen unter den Schutz der Meinungsfreiheit fallen, wissenschaftliche Publikationen aber nicht?
Vance sieht wohl den Splitter im Auge der anderen, nicht aber den Balken im eigenen Auge. Seinen Argumenten fehlte es an jedem Verständnis für Verhältnismäßigkeit. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, Vance habe große Partien seiner Rede als Lobbyist für Elon Musk konzipiert, dem es um die komplette Deregulierung des Internets aus reiner Profitgier geht. Dies wirft im Anschluss die Frage auf, ob in der gegenwärtigen Regierung Präsident Trump oder der umtriebige südafrikanische Milliardär das Sagen hat. Im Moment jedenfalls wirkt Trump nicht wie der starke Mann, als den er sich gerne sieht, sondern wie eine Marionette der ihn umgebenden Oligarchen.
Eines ist Vance indes gelungen: Er hat in München augenblicklich die diskursive Hegemonie errungen. Von Stunde an drehte sich die Konferenz ausschließlich um seine Rede, und die Deutschen reagierten, wie Deutsche immer reagieren, indem sie in provinziellem Dünkel alles auf sich bezogen. Dabei standen die notorische “Brandmauer” und damit Deutschland gar nicht im Mittelpunkt der Ausführungen, sondern die Angriffe des Vizepräsidenten richteten sich ausgerechnet gegen Großbritannien und Schweden, zwei ausgesprochen treue Alliierte, die ihren militärischen Verpflichtungen bislang entschieden nachgekommen sind.
Zynische Politik der unbedingten Disruption
Das alles in einer Situation, wo die Gegner des Westens – Russland und China – immer aktiver werden. Aber eine US-Regierung, die einzig die Macht der Macht anbetet, redet zwar von Werten, praktiziert aber eine zynische Politik der unbedingten und ziellosen Disruption, an deren Ende nicht unbedingt der Sieg der eigenen Sache stehen wird, sondern eine Schwächung der USA und ihrer Verbündeten.
Was aber Vance persönlich angeht, so belegt sein Verweis auf den heiligen Papst Johannes Paul II., wie rein funktional und selektiv sein Katholizismus ist. Nichts an seiner Rede oder am Handeln der Administration deutet auf ein vertieftes Verständnis der naturrechtlichen Tradition, der katholischen Soziallehre oder der katholischen Tugendethik hin. Solche “Freunde” können gefährlicher sein als viele Feinde.
Der Autor hat an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität eine Professur für Nordamerikanische Kulturgeschichte, Empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie inne.
Katholischen Journalismus stärken
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Stärken Sie katholischen Journalismus!
Unterstützen Sie die Tagespost Stiftung mit Ihrer Spende.
Spenden Sie direkt. Einfach den Spendenbutton anklicken und Ihre Spendenoption auswählen:
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.
Themen & Autoren
Michael Hochgeschwender
Alternative für Deutschland
Donald Trump
J. D. Vance
Johannes Paul II.
Katholische Soziallehre
Meinungsfreiheit
Päpste
US-Regierung
Wladimir Wladimirowitsch Putin
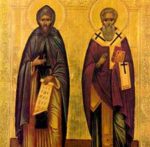 Quelle
Quelle


Schreibe einen Kommentar