Ohne Bildungsbürger zerfällt Europa
Die Tagespsot, 29.02.2012, von Christoph Böhr
Der kulturpolitisch gewollte radikale Abbau an den Universitäten und die gesellschaftliche Geringschätzung der Geisteswissenschaften gefährdet den vielbeschworenen Diskurs über Werte und Wertegemeinschaft. Wenn eine humanistische Kultur durch die Allmacht des ökonomischen, bourgeoisen Nutzengedankens abgelöst zu werden droht, müssen die Alarmglocken schrillen – gerade mit Blick auf Europa.
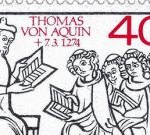 Im Mittelalter beherrschten im Abendland grosse Lehrer wie Thomas von Aquin und die Studenten an den Universitäten europaweit eine gemeinsame Grammatik des Geistes, mit deren Hilfe sie gleichermassen die Argumente des Gegners wertschätzen wie die eigenen schärfen lernten (disputatio) – das brachte eine intellektuelle europäische Blüte empor, was nicht allein an Latein als der gemeinsamen Sprache, der sogenannten franca lingua lag. Dieses Erbe verspielt der Wissenschaftsbetrieb von heute – allein dieses Wort Wissenschaftsbetrieb spricht Bände. Lange ist es auch schon her, dass die damalige “Deutsche Bundespost” Thomas von Aquin (Ausriss Briefmarke) und damit dieser Idee der Bildung die Ehre erwies.
Im Mittelalter beherrschten im Abendland grosse Lehrer wie Thomas von Aquin und die Studenten an den Universitäten europaweit eine gemeinsame Grammatik des Geistes, mit deren Hilfe sie gleichermassen die Argumente des Gegners wertschätzen wie die eigenen schärfen lernten (disputatio) – das brachte eine intellektuelle europäische Blüte empor, was nicht allein an Latein als der gemeinsamen Sprache, der sogenannten franca lingua lag. Dieses Erbe verspielt der Wissenschaftsbetrieb von heute – allein dieses Wort Wissenschaftsbetrieb spricht Bände. Lange ist es auch schon her, dass die damalige “Deutsche Bundespost” Thomas von Aquin (Ausriss Briefmarke) und damit dieser Idee der Bildung die Ehre erwies.
Foto: INT
Seit rund einem halben Jahrhundert gehört es im westlichen Europa zum guten Ton, den Begriff der Bildung zu verunglimpfen. Deren frühere Wertschätzung sei nichts anderes gewesen, so wird behauptet, als eine Ersatzhandlung – eine das Gefühl von Hochnäsigkeit und Stolz beflügelnde Einstellung des in Deutschland nie zur Politik zugelassenen Bürgers. Was lag da näher, als Bildung nur noch in der Form des Beiwortes zu nennen: als Eigenschaft des machtlosen, entmündigten, von den Entscheidungen über den Lauf der Welt ferngehaltenen Bürgertums – als Bildungsbürgertum eben.
Das ist, wie bei Theodor Fontane unnachahmlich geschildert, gleich zwischen alle gesellschaftlichen Fronten gerutscht: Nicht nur, dass es die Verachtung des Adels erdulden musste. Nein, auch sein erfolgreicher Zwilling, der Bourgeois, also der wirtschaftlich erfolgreiche und schon bald steinreiche Wirtschaftsbürger, kannte nur Mitleid für das kleine Glück des verarmten Mitglieds der Familie, den Bildungsbürger. Ihm war alles Glamouröse und Mondäne, nach dem der Bourgeois um jeden Preis strebte, fern. Und diese Ferne zu allem Blendwerk bot dann auch den Ansatzpunkt für das von ihm gezeichnete Bild der Lächerlichkeit: Der Bildungsbürger erschien als Zerrbild einer weltfremden, die Not zur Tugend kehrenden Lebensweise, die nach Höherem und Geistigem strebte, aber nur Spott verdiente, weil sie unfähig schien, auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen.
Während ihm so von allen Seiten Naserümpfen entgegengebracht wurde, erbrachte der Bildungsbürger tatsächlich einsame Höchstleistungen. Allein ein Blick in das Angebot deutscher Hochschulen im späteren 19. und im frühen 20. Jahrhundert spricht in dieser Hinsicht Bände. Es gab kein Land und keine Zeit, in dem und zu der die Wissenschaft ähnlich in Blüte stand – und zwar im gesamten breiten, ständig sich erweiternden Kanon der Disziplinen. Es gab, wichtiger noch, zudem ein gemeinsames Verständnis in Anspruch und Form wissenschaftlicher Arbeit, eine Verständigung zwischen den unterschiedlichsten Fächern als die Kenntnis einer verbindenden geistigen Grammatik, die ihrerseits wiederum Voraussetzung jeder Fähigkeit zum übergreifenden, einbeziehenden Gespräch ist. Nicht zuletzt dieser Austausch zwischen Menschen, die wissenschaftlich auf weit entlegenen Feldern arbeiteten, trug reiche Frucht.
Ein schönes Beispiel ist die damalige Forschung über ein Thema, das heute wieder hoch im Kurs steht: nämlich die Beschäftigung mit dem Islam. Wer sich für dieses Thema interessiert, stösst auf Schritt und Tritt auf Arbeiten, die im 19. und im frühen 20. Jahrhundert veröffentlicht wurden. Sicher sind heute die Textkritik fortgeschrittener und die Geschichtsforschung weiter. Wer sich jedoch – zum Beispiel als Philosoph, der nicht in der Arabistik bewandert ist – mit dem Gottes- und Menschenbild des Islam auseinandersetzt, weil er diesen Fragen im Rahmen seiner eigenen Forschungen gar nicht ausweichen kann und will, lernt unsäglich viel beispielsweise aus den Büchern eines Marcus Joseph Müller (1809–1874) oder eines Ignaz Goldziher (1850–1921). Er lernt nicht allein viel im Blick auf Antworten, sondern mindestens ebenso viel im Blick auf weiterführende Fragestellungen.
Nun soll nicht dem nostalgischen Revival vergangener Wissenschaftskulturen das Wort geredet werden. Es geht um anderes: Nämlich um die Frage, ob wir uns auf Dauer wirklich den Abbruch der Geisteswissenschaften – und damit der ihnen eigenen Fragestellungen – in Deutschland widerstandslos leisten wollen. Die geradezu blindwütige Liquidierung kleiner Fächer – erinnert sei nur an die Byzantinistik – und deren Konzentration an einigen wenigen Standorten reisst eine Lücke, von der manche behaupten, dass dieser Verlust belanglos sei. Es sind dies oft die gleichen Leute, die beim besten Willen nicht begreifen können, warum Griechen, Bulgaren und Russen sich hier und dort so und nicht anders verhalten. Der trübe Blick auf kaum bekannte unterschiedliche Prägungen gebiert ein Missverständnis nach dem anderen, führt – bestenfalls – zur Sprachlosigkeit und schlimmstenfalls zu Hass. Wer aber mangels Bildung nichts über die beiden europäischen Traditionen der weströmischen und der oströmischen Christenheit weiss, der ist noch nicht einmal in der Lage, die durch seine blanke Unkenntnis bedingte Trübung des eigenen Blicks überhaupt zu bemerken. Am Ende bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als zu sprechen wie der Blinde von der Farbe.
Das ist schwierig, weil – um beim genannten Beispiel zu bleiben – beide europäische Traditionen heute unter einem Dach des immer wieder so bezeichneten europäischen Hauses zusammenleben. Und auf der Suche nach einer gemeinsamen Hausordnung ist uns im Westen – und besonders uns Deutschen – jene Kenntnis abhanden gekommen, die uns zumindest erahnen lässt, wie unsere Zimmernachbarn erzogen wurden, kurz: welche Bildung sie genossen haben. Denn der in Deutschland lange geforderte, und heute an Schule und Hochschule meist geübte Verzicht auf Bildung gehört gottlob nicht zum Selbstverständnis unserer Nachbarn in der Mitte und im Osten des Kontinents. Die wundern sich nur, wenn sie nach Deutschland blicken – und können auch in dieser Hinsicht nicht verstehen, was uns umtreibt.
Die Erosion des abendländischen Bildungsbegriffs ist weit vorangeschritten. Man lasse diese Feststellung einmal so stehen, auch wenn hier und im Folgenden nicht haarklein beschrieben wird, was denn unter diesem abendländischen Bildungsbegriff genauer zu verstehen sei. Dass es ihn gab, wurde spätestens bewusst, als er verloren gegangen war. Kürzlich hat (in der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” am 17. Februar) der französische Historiker Pierre Nora, Herausgeber von “Le débat” und Mitglied der Academie française, darauf hingewiesen, dass die Wissenschaft in Europa den Zugang zu einem breiteren Publikum verloren habe, weil ihr – der Wissenschaft – eine gewisse Grammatik des Geistes fehle, die einst von der humanistischen Bildung bereitgestellt worden sei.
Nora wörtlich: Unsere “gemeinsame Zivilisation befindet sich in einer Krise. Die humanistische Kultur – Latein, Griechisch, Geschichte, Philosophie, Sprachen – ist am Ende. Sie einte einst die europäischen Eliten, aber sie ist im Verschwinden begriffen (…). All das hat zur Zersplitterung der kulturellen Landschaft Europas geführt. Es gibt keine europäische Öffentlichkeit, weil eine echte, von der Mehrzahl der Europäer geteilte Wertegemeinschaft fehlt.”
Der Begriff von Bildung wurde hierzulande durch ein Verständnis von Ausbildung ersetzt, das sich ausschliesslich an Nutzbarkeit und wirtschaftlicher Verwertbarkeit orientiert. Ein allein an seinem Nutzen bemessenes Wissen erweist sich jedoch auf die Dauer als unbrauchbar, weil es die Massstäbe seiner eigenen Anwendung aus dem Blick verliert.
Und ein Weiteres kommt hinzu: Je mehr Wissenschaft sich spezialisiert und spezifiziert, umso gefährdeter ist das Wissen um die Grundlagen, auf denen gerade jene in hohem Masse spezialisierten Wissenschaften aufbauen: Grundlagen, die ihr Selbstverständnis berühren, das nur bewahrt werden kann, wenn der Wissenschaftler jene Grammatik des Geistes kennt, in der die Grundlagen und Zielsetzungen seines Tuns beschrieben werden können. Diese Grammatik des Geistes – um das Wort Noras hier aufzunehmen – ist so etwas wie das Gedächtnis Europas, in dem jene Fragen bewahrt werden, die in besonderer Weise den Fortgang des Denkens beflügelt haben. Es liegt in der Natur der Sache, dass solche Fragen, wenn sie denn diese Eigenschaft, das Denken zu beflügeln, besitzen sollen, samt und sonders uralte Fragen sind: Fragen, auf die schon tausende Male eine Antwort gegeben wurde – Antworten allerdings, die sich als unzulänglich, strittig und mithin erörterungsbedürftig herausstellten. Alle diese Antworten tragen – wie könnte es anders sein? – die Signaturen ihrer Zeit. Doch es ist nicht Zeitgebundenheit dieser Antworten, die dazu führte, dass später Geborene über die alten Fragen neu nachdachten. Es ist die Frage selbst, ihr bohrender, beunruhigender, brennender Inhalt: gebündelt in der einen Frage nach dem Woher und dem Wohin des Menschen.
Im Mittelpunkt der europäischen Tradition des Denkens steht eben diese Frage: nach dem Menschen. So kann es nicht verwundern, dass die Religion der Europäer, das Christentum, Gott auf eine Weise denkt, wie keine andere Religion das tut: in seiner Verbindung mit dem nach seinem Bild geschaffenen Menschen. In dieser Hinsicht ist Europa Erbe des Judentums. Und in einer einzigartigen, unvergleichlichen Verschmelzung des Denkens in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten (auf eine vergleichbare Interkulturalität wäre man heute zu Recht mehr als stolz) wurde eine Grammatik des Geistes im Denken über den Menschen – als Regel des Denkens überhaupt – entwickelt, die uns derzeit abhanden zu kommen droht.
Diese Einsicht müsste Anlass für eine Besinnung sein. Denn es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, dass Nora Recht hat: “Die Wissenschaft verliert den Zugang zum breiteren Publikum, weil ihr eine gewisse Grammatik des Geistes fehlt, die einst von der humanistischen Bildung bereitgestellt wurde.” Deshalb ist es ein so vergebliches Mühen, auf eine europäische Öffentlichkeit zu hoffen. Nach welcher Grammatik soll die Kommunikation, der eine Öffentlichkeit den Rahmen setzt, erfolgen? Jede Öffentlichkeit benötigt ein Medium, in dem sie sich verständigt. Wenn Verständigung gelingen soll, muss Verstehen möglich sein. Aber gibt es ein wechselseitiges Verstehen ohne die Bezugnahme auf eine gemeinsame Grammatik des Geistes aller am Gespräch Beteiligten?
Eine heute gelegentlich zu beobachtende neue Wertschätzung des europäischen Mittelalters hat hier vielleicht ihren Grund. Es gab damals diese Grammatik des Geistes – das ist, wohlgemerkt, etwas anderes und weit mehr als eine lingua franca: nämlich jene Regeln, die sicherstellten, dass man nicht aneinander vorbei redete.
Ihre vielleicht schönste und vollendete Form hat diese Grammatik des Geistes in der literarischen Figur der quaestio disputata gefunden. Deren Anerkennung und Erfolg hingen davon ab, dass es dem Autor gelingt, die Argumente seiner Gegner stärker und kräftiger zu machen, bevor er zu ihrer Widerlegung schritt. Es galt, den Gegner nicht klein zu reden, sondern ihn im Licht seiner eigenen Begründung gross zu machen.
Die Regel der Wissenschaft war hier unmittelbare Folge eines Menschenbildes, das für selbstverständlich hielt, auch dem Andersdenkenden uneingeschränkt Achtung zu zollen und Vernunft zu unterstellen. So entstand eine Öffentlichkeit, die der nicht zur Kenntnis nehmen will, wer deren Entstehung erst mit den – verdienstvollen – Salons des späten 18. Jahrhunderts beginnen lässt. Die europäische Gesprächskultur beginnt früher, in der griechischen Antike, und findet zu einer neuen Blüte im europäischen Mittelalter.
Wie weit haben wir uns von dieser Denkhaltung heute, da eher als erfolgreich gilt, wer andere mundtot macht, entfernt? Und je weiter wir uns entfernt haben, umso mehr ging uns verloren, was Nora die Grammatik des Geistes nennt – jene unverzichtbare Voraussetzung, die den Zusammenhang zwischen Verständigung und Verstehen nicht leugnet.
Statt Konferenz um Konferenz einzuberufen, um hastig immer dieselben Redner nach “den Werten” zu fragen, die gleich funkelnden Sternen am nächtlichen Himmel dem Seefahrer helfen sollen, sein Schiff zu steuern, täte Europa gut daran, sich jener Wertegemeinschaft zu vergewissern, die Nora eine Grammatik des Geistes nennt – Regeln also, die von der Bereitschaft, der Fähigkeit und dem Willen zu Verstehen und Verständigung des eigenen Erbes geprägt sind.
Betriebswirtschaftlich auf Vordermann gebracht, haben wir uns, wo früher von universitas und disputatio die Rede war, das Wort vom Wissenschaftsbetrieb angeeignet. Es zählt, in Fontanes Worten seiner Kritik am Bourgeois, ausschliesslich der Sinn für das Ponderable, nämlich für alles, was ins Gewicht fällt und Zins trägt. Aber gibt es Wissenschaft zu diesen Bedingungen? Als Betrieb zur Herstellung beruflicher Fertigkeiten? Der Blick in deutsche Hochschulen zeigt: Deren Betriebsamkeit und Unternehmensgeist sind kaum noch zu steigern. Wessen Stelle und Arbeit von der Höhe der eingeworbenen Drittmittel abhängt, weiss ein Lied davon zu singen. Bedauerlicherweise kamen Wissenschaft und Bildung dabei unter die Räder, jedenfalls dort, wo sie sich nicht unbeobachtet und ohne öffentliche Zuschüsse in Nischen flüchten konnten.
Auch heute gibt es eine Fülle von Fragen und Antworten, die sich beim besten Willen nicht evaluieren lassen, weil sie sich dem Massstab des Ponderablen entziehen. Sie haben ihren Ort in jener Wissenschaft, die keinen Marktpreis hat, sondern – um die von Immanuel Kant in einem anderen Zusammenhang getroffene Unterscheidung aufzunehmen – einen inneren Wert besitzt. Den zu erkennen und zu entdecken macht die Menschen weder dümmer noch lebensuntauglicher. Die Möglichkeit, diese Wissenschaft – die um ihrer selbst willen zu schätzen ist, weil sie Zweck und nicht Mittel ist – darf nicht auch noch in ihren Restbeständen verjagt werden. Vielleicht erfüllt sich diese Hoffnung, ohne ein Wunder erbitten zu müssen: Denn der Verlust, den so viele spüren, ist nicht nur Folge eines Niedergangs, sondern birgt auch die Möglichkeit eines neuen Aufstiegs.


Schreibe einen Kommentar