Mister Lynch und die Banausen
Ein Loblied auf die Etymologie: Wer danach gräbt, woher ein Wort kommt, wer es geprägt hat und was es ursprünglich bedeutete, wird nicht selten mit einem Aha-Erlebnis belohnt
20.09.2025
“Ein Wörtlein”, meinte einst Martin Luther, kann den Teufel fällen. Es spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, dass Luther den Teufel in ziemlicher Nähe zum Papst und zur Papstkirche sah, die er durch die Macht des Wortes fallen sah. Worte haben eine eigene Macht in sich. Worte können Welten heraufrufen und Seelenräume aufschließen. Sie können Brandsätze sein, können funkeln und faszinieren, mitreißen oder fortreißen. “Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen”, erkannte schon Mark Twain, “ist derselbe Unterschied wie zwischen dem Blitz und einem Glühwürmchen.”
Schriftsteller sind Leute, die Glühwürmchen meiden. Sie suchen im ABC immer nach dem Blitz, der die Nacht erhellt. Sie drehen und wenden die Worte, schauen sie von allen Seiten an, suchen nach immer neuen Ausdrucksvarianten, die noch treffender etwas Wirkliches zum Leuchten bringen. Im Laufe der Jahre habe ich eine eigentümliche Liebe zur Etymologie entwickelt. Darunter versteht man die Wissenschaft von der Herkunft und Geschichte der Wörter und ihrer Bedeutungen.
Was hätte Platon zu den digitalen Banausen unserer Tage gesagt?
Machen wir die Probe aufs Exempel: Woher kommt “Etymologie”? Das Wort ist eine Komposition von zwei altgriechischen Wörtern, nämlich von étymos (“wahr, wahrhaft, echt, wirklich”) und lógos (“Wort, Sinn, Wissenschaft”). Es geht also, wie Max Pfister einmal sagte, um die “Suche nach dem jedem Wort innewohnenden Wahren.” Wenn ich schreibe, liegen zwei Bücher immer in meiner Nähe: der “Helbig” (“Zur Bedeutung der Wörter – Ein illustriertes Lexikon für gebildete Bürger”) und der “Duden” (“Das Herkunftswörterbuch”). Sie sind mir gewissermaßen zugeflogen. Eines Tages habe ich entdeckt, dass sie immer in Greifweite liegen, weil ich hundertmal erfahren habe, dass mir Lichter aufgehen, wenn ich danach grabe, woher ein Wort kommt, wer es geprägt hat, was es ursprünglich bedeutete.
Manchmal ist die Geschichte banal: “Lynchen” kommt nicht etwa aus dem Altgriechischen. Und auch wenn man weiß, dass “to lynch” ursprünglich in Amerika aufkam, so hellt sich das Dunkel erst richtig auf, wenn man hört, dass es im Virginia des 18. Jahrhunderts wohl einen Farmer namens Mister Lynch gab, der so eindrucksvoll und eigenhändig der Rechtsprechung Nachdruck gab, dass er seinem Familiennamen eine mittlere Unsterblichkeit verschaffte.
Manchmal führt das wörtliche Tiefergraben direkt in die Philosophie, – etwa beim “Banausen”, dem vielleicht ältesten Schimpfwort des Abendlandes. Wenn wir heute darunter einen wertblinden Spießbürger verstehen, der keine geistigen oder künstlerischen Interessen hat (Nietzsche: “Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht: aber man ehrt die Gesundheit”), so hat sich Platons Kritik an jenen flachen Zeitgenossen gut erhalten, deren Horizont nur aus Zweckdenken besteht und Gerechtigkeit, Wahrheit und Weisheit aus ihrem Handlungsrepertoire ausgeblendet haben. Was würde Platon wohl zu den technoiden oder digitalen Banausen unserer Tage sagen? Zum Trost sei es gesagt: Philosophie kommt wieder!
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.
Themen & Autoren
Bernhard Meuser
Friedrich Nietzsche
Mark Twain
Martin Luther
Platon
Teufel (Religion)
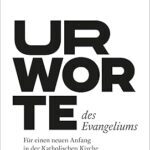 Quelle
Quelle

Schreibe einen Kommentar