Wie das Christentum Nordeuropa das Denken beibrachte
Geschichte – Wissen aus dem Glauben – Sind Religion und Wissenschaft Gegensätze? Ganz im Gegenteil, Wissen entstand aus dem Glauben. Teil 1 unserer historischen Miniserie: Spätantike und Mittelalter

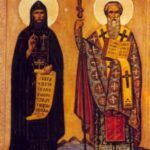 Quelle
Quelle
Die Kirche und die Wissenschaft: Wenn Glaube den Forschergeist weckt – katholisch.de
Kyrill & Method
Klosterinsel Reichenau
20.04.2025
Wann beginnt der Mensch, wissenschaftlich zu arbeiten?
Wann und unter welchen Bedingungen entsteht Wissenschaft?
Diese Frage lässt sich sehr weit gefasst beantworten oder auch sehr eng geführt. Die weite Fassung rekurriert auf das prähistorische Spurenlesen. Noch bevor es Schrift gab, die man lesen konnte, haben die Menschen schon vor mehreren zehntausend Jahren Spuren und Fährten von Tieren gelesen und analysiert, um Informationen über diese Tiere zu erhalten, etwa ihr Geschlecht, ihre Geschwindigkeit und ihren Gesundheitszustand. Das mussten sie tun, um erfolgreich jagen zu können, denn die gejagten Tiere waren größer und schneller als der Mensch.
Ihnen war nur mit Informationen, mit Daten beizukommen. Das ist ein erster wissenschaftlicher Ansatz in der Menschheitsgeschichte. Damit wäre eine Wissenschaftsgeschichte in einem sehr weiten Sinne geschrieben.
Die enge Fassung bezieht sich auf die Gründung der großen Wissenschaftsorganisationen in Europa und den Beginn der spezifischen Forschungsarbeit im 17. Jahrhundert mit sich immer weiter ausdifferenzierenden Wissensgebieten. 1660 wird in England die Royal Society gegründet, 1700 die Preußische Akademie der Wissenschaften, etwas später, nämlich 1847, die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Im 19. Jahrhundert beginnen auch einzelne Fachgesellschaften mit einer organisationalen Vernetzung der Forschenden und einer Bündelung des Wissens ihrer Disziplin; die Astronomische Gesellschaft von 1800 ist die erste ihrer Art in Deutschland, es folgen etwa die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte (1822) und die Deutsche Physikalische Gesellschaft (1845). Das wäre Wissenschaftsgeschichte in einem engen Sinne.
Wissenschaft braucht Sprache
Es gibt aber auch eine Antwort mittlerer Reichweite. Bei ihr hat die Religion eine besondere Funktion. Zu denken ist hier vor allem an die Einflüsse des Christentums auf Wissenschaft und Bildung. Wissen entsteht aus dem Glauben. Damit sind nicht nur die Beiträge christlicher Forscher gemeint, die einen Bezug zum Glauben haben, sondern auch dieser Glaube selbst. Oft hört man, dass Wissenschaftler, die an Gott glauben, ihren religiösen Glauben im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit ablegen müssten. Das stimmt, jedenfalls soweit Wissenschaft nach einer Methodik funktioniert, die religions- und weltanschauungsübergreifend ist, also unabhängig ist vom Glauben. Dennoch hat der christliche Glaube an einigen entscheidenden Stellen der Wissenschafts- und Bildungsgeschichte eine tragende, motivierende und inspirierende Rolle gespielt.
Wissenskultur braucht Verstetigung. Wissenschaft kann nur entstehen und bestehen, wenn es eine geeignete Denkform gibt, die sich in Sprache und Schrift ausdrückt. Die Sprache formt das Denken, das Denken bringt die Kultur hervor. Europa lernt mit den Missionaren nicht nur den Erlöser Jesus Christus kennen, sondern auch Lesen und Schreiben. Denn das Christentum “hatte zur Grundlage das Buch der Bibel, weswegen Lesen, Schreiben wie noch Auslegung erforderlich waren”, so der Kirchenhistoriker Arnold Angenendt. Die christlichen Missionare brachten ab dem 6. Jahrhundert also nicht nur eine neue Religion nach Mittel-, Ost- und Nordeuropa, sondern auch die Schriftkultur, mit der eine verstetigte Überlieferung auch jenseits des eigenen Stammes möglich wurde. Kyrill von Saloniki, ein Missionar aus dem 9. Jahrhundert, ist ein gutes Beispiel für die kulturelle Emporentwicklung, die Europa mit dem Christentum nahm. Kyrill schuf das erste slawische Alphabet, die glagolitische Schrift, aus der später die nach ihm benannte kyrillische Schrift entstand.
Von der Sprache zum Gedanken
So entsteht mit der christlichen Mission aus illiteraten Tribalstrukturen, also von Analphabeten, allmählich die Grundlage der europäischen Wissensgesellschaft. Angenendt betrachtet die Mission daher insbesondere als Aufeinandertreffen von christlicher Hochkultur und heidnischer Einfachkultur: “Welten von ganz unterschiedlichem Niveau prallten aufeinander, einerseits mit Philosophen, Juristen, Gesetzen und Gerichten und andererseits mit Brauchtum, Ordal und brachialem Zweikampf; einerseits Schulen mit Lesen und Schreiben und andererseits Stammessagen mit rituellem Zauber.” Das Christentum brachte eine Sprache mit abstrakten Begriffen, die es in den germanischen und slawischen Stämmen nicht gab, und ermöglichte so eine Denkform, für die die Menschen in Mittel-, Ost- und Nordeuropa zuvor kein Gespür hatten. Wissenschaft ist angewiesen auf diese Denkform. Und auf Sprache, verschriftlichte Sprache, denn nur so kann das Gedachte tradiert werden.
Das war kein leichter Weg. Den germanischen und slawischen Stämmen fehlte die differenzierte Begrifflichkeit und das hohe Abstraktionsniveau des Griechischen oder Lateinischen, mithin Aspekte, die für philosophische und wissenschaftliche Überlegungen nötig sind. “Jeder höhere Gedanke, jede theologische Spekulation, jede Wissenschaft entzog sich noch ihrem Sprachvolumen”, resümiert der Mediävist Johannes Fried. Das wird durch die christliche Mission langsam, aber kontinuierlich erweitert. Damit formte das Christentum ein neues Denken, ein Denken in Abstrakta, das vor allem die Wissenschaft, aber auch das Rechtswesen in Europa beflügelte.
Von der Schrift zur Schule
Die Etablierung der Kulturtechniken Lesen und Schreiben ging mit einer Institutionalisierung der Bildung und Pflege der neuen Fähigkeiten einher. Auch hierbei spielt das Christentum eine Schlüsselrolle: Schulen und Bibliotheken gab es nördlich der Alpen erst, als dort Kirchen und Klöster errichtet wurden. An diesen unmittelbar angeschlossen waren ab Ende des 6. Jahrhunderts Kathedral- und Klosterschulen, die erste in der englischen Bischofsstadt Canterbury (597), die erste im deutschsprachigen Raum auf der Bodenseeinsel Reichenau (724). Sie hatten als konkurrenzlose Einrichtungen eine herausragende Bildungsfunktion, weit hinaus über das, was man heute unter “Schule” versteht. Es gab dort zum Beispiel die ersten Ansätze für eine medizinische Ausbildung.
Nachdem in England das Schulwesen seit langem zu blühen begonnen hatte – neben Canterbury entstehen berühmte Schulen in Rochester (604) und York (627) – zog mit einem guten Jahrhundert Verspätung die kontinentaleuropäische Kirche nach, neben Reichenau sind die Schulgründungen in Fulda (748), Prüm (752) und Hersfeld (769) erwähnenswert. Rückenwind bekommt das kirchliche Bildungssystem mit dem 789 erlassenen Kapitular “Admonitio generalis” von Karl dem Großen, denn es enthält die Anweisung, dass an jedem Bischofssitz und jedem Kloster eine Schule gegründet werden musste. Das führte zur Gründung zahlreicher Domschulen (etwa in Lüttich, Köln, Bamberg und Würzburg), in denen die künftige Elite Europas neben Lesen und Schreiben auch lernte, den Ostertermin korrekt zu berechnen. In den höheren Jahrgangsstufen wurde nach antikem Vorbild eine breitgefächerte Ausbildung in den sieben freien Künsten angeboten; auf dem Stundenplan standen Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik.
Von der Schule zur Universität
Der nächste Schritt ist die Gründung von Universitäten, oft aus den Schulen heraus. Ein gutes Beispiel dafür ist die Universität Parma im Jahre 962, die sich auf das Studium eben jener freien Künste bezieht; erst im 13. Jahrhundert kamen die juristische und medizinische Fakultät hinzu. Fast drei Jahrhunderte lang war sie also das, was man heute “Oberstufenzentrum” nennen würde. Die erste “richtige” Universität ist in Bologna entstanden, als Gründungsjahr gilt 1088. Doch auch hier ist die Bezeichnung “Universität” anfangs schmeichelhaft, es handelte sich eher um eine Rechtsschule, denn Jura war der einzige Studiengang. Auch in Oxford begann man zu dieser Zeit mit dem (ebenfalls noch eher schulischen) Lehrbetrieb, die Quellen lassen uns dessen Anfänge auf das Jahr 1096 datieren. Auch die renommierte Pariser Universität entstand aus einer Domschule.
Erkennbar ist die christliche Hervorbringung der Universitäten oft bis heute an Namen und Symbolen; “Dominus Illuminatio Mea” (dt.: “Der Herr ist mein Licht”) – Psalm 27,1 ziert das Wappen der Universität Oxford. Überall in Europa entstehen ab dem 13. Jahrhundert Universitäten – gegründet mit päpstlichem Segen. Später wurde die christlich-europäische Schul- und Universitätsidee mit den Missionaren nach Übersee exportiert; 1538 entsteht in Santo Domingo die Universidad Santo Tomás de Aquino aus dem Studium Generale, das die Dominikaner 1518 eingerichtet hatten. Universitätsgründungen in Lima (1551) und Mexiko-Stadt (1553) folgen. Noch heute sind die Dominikaner, aber auch die Franziskaner und Jesuiten Träger vieler Bildungseinrichtungen in Amerika, Afrika, Asien und Australien.
Teil 2 erscheint am 24. April.
Katholischen Journalismus stärken
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Stärken Sie katholischen Journalismus!
Unterstützen Sie die Tagespost Stiftung mit Ihrer Spende.
Spenden Sie direkt. Einfach den Spendenbutton anklicken und Ihre Spendenoption auswählen:
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.
Themen & Autoren
Josef Bordat
Bischofssitze
Carolus Magnus
Christliche Mission
Glaube
Jesus Christus
Johannes Fried
Päpste
Universität Oxford



Schreibe einen Kommentar