Die Macht der Milliardäre
Tech-Mogule vom Typus Elon Musk scheinen Geld und Macht auf nie dagewesene Weise in sich zu vereinen. Manche sehen sie als politische Heilsbringer. David Engels fragt: Zu Recht?
10.04.2025
Wir leben heute in einer Ordnung, die am besten als “Milliardärssozialismus” bezeichnet werden kann: Glaube, Tradition, Familie, Heimat – allesamt sind sie bis auf wenige Spurenelemente aus der gelebten Gesellschaft verschwunden; selbst die vielberufene “Demokratie” ist wenig mehr als ein Ausführungsorgan für Entscheidungen geworden, die längst anderswo gefällt werden. Die wahre Macht liegt in den Händen jener, die reich genug sind, nicht nur die Massenmedien zu steuern, sondern durch ihre Beteiligung an den großen Korporationen, Funds und Holdings auch einen Gutteil des Volksvermögens zu kontrollieren – und die zudem durch ihr Monopol an verschiedenen Formen von “Big Tech” faktisch die strategische Zukunft ganzer Erdteile in ihren Händen halten.
Ihr Vermögen ist weitgehend durch die stille, manchmal sogar freiwillige Enteignung der Mittelklasse der Boomer-Generation zustande gekommen. Diese hat dem eigenen goldenen Lebensabend die Interessen der Nachkommen geopfert, so dass den neuen Cäsaren wie vor zweitausend Jahren nur noch eine weitgehend entwurzelte, von Brot und Spielen bei Laune gehaltene und mit sogenannten Bullshit-Jobs beschäftigte Masse entgegensteht. Letztere wird durch endlose Kulturkämpfe und Identitätskonflikte mit sich selbst beschäftigt; ihr gelegentlicher Unwille wird bei Bedarf höchst geschickt auf einzelne äußere Gegner, globale Notstände oder ausgewählte Parteien umgeleitet.
Ist zum Verhältnis von “Macht und Geld” alles gesagt?
Wie sollte man das Verhältnis von “Macht und Geld” richtig beurteilen? Zu diesem Thema ist eigentlich schon alles gesagt worden, seit Christus erklärt hat: “Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen!” (Mk 10,23), es aber Maria von Bethanien kurz vor seiner Kreuzigung nicht verwehrte, seine Füße mit teurem Nardenöl zu salben, anstatt dieses zugunsten der Armen zu verkaufen. Denn: “Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer” (Joh 12,8). Die Botschaft ist deutlich: Wer irdisches Gut um seiner selbst willen sammelt und hortet, wird sich dadurch dereinst selber richten; wer aber das Irdische immer wieder in die Transzendenz hin wendet und sublimiert, erfüllt den göttlichen Auftrag.
Dabei geht es eigentlich nur bedingt um “Reichtum” im Sinne des Bankkontos; auch die Beschränkung unseres irdischen Strebens auf Güter wie Schönheit, Wissen, Liebe, Macht oder Ruhm fällt unter das eindeutige Verdikt des Herrn. Und daher irrt auch, wer das berühmte Gleichnis von Kamel und Nadelöhr im Sinne von Kapitalismuskritik oder als Aufruf nach sozialer Gerechtigkeit versteht: Christus geht es nicht um eine effizientere sozialistische Güterverteilung, sondern um die Sorge, dass eine allzu große Ausrichtung auf das Irdische den Blick auf das eigentlich Wesentliche, also das Jenseitige trübt. Nur wenn das irdische Gut im symbolischen wie im realen Sinne Gott verherrlicht und immer wieder auf ihn bezogen wird, kann auch das Diesseits geheiligt werden.
Das heißt also: Nur wenn der Reichtum Gott dient, wenn die Schönheit auch auf das Wahre verweist, wenn das Wissen die Gottessuche unterstützt, wenn die Einzelliebe nicht den Blick auf Gott verstellt, wenn die Macht nicht zum Selbstzweck degeneriert, wenn der Ruhm nur “ad maiorem Dei gloriam” – zur größeren Ehre Gottes – gesucht wird – nur dann mag aus irdischem Gut Segen entspringen. Aber wer dies einmal verstanden hat: Wozu sollte der sich noch weiter um das Aufhäufen von Reichtümern bemühen, wo er doch weiß, dass es letzten Endes immer nur um den “Schatz im Himmel” geht (Mt 6,20), der zudem nur an einem einzigen Ort gesammelt werden kann, nämlich unserem Inneren, da doch “das Reich Gottes in Euch selbst ist” (Lk 17,21)?
Damit ist aber auch der Leseschlüssel für die Geschichte der letzten tausend Jahre abendländischer Geschichte gegeben – und unserer Gegenwart. Niemand würde es bezweifeln, dass das Streben nach dem Irdischen wie das nach dem Jenseitigen dem Menschen an allen Orten und zu allen Zeiten eingeboren ist. Und doch steht nicht zu bezweifeln, dass gewisse Orte und Zeiten teils dem einen, teils dem anderen eher zuträglich waren und sind.
Die Ordnung des Mittelalters
Das Mittelalter als die erste Phase unserer abendländischen Geschichte hat fraglos auch seinen Teil an höchst unchristlicher Sucht nach oberflächlichen Gütern gesehen; trotzdem fand hier der Wunsch, alles Diesseitige auf das Jenseits hin zu ordnen und zu verklären, seinen unbestrittenen Höhepunkt. Das Wissen der Klöster, die Macht des christlichen Königtums, die Schönheit der Kathedralen, der Ruhm der Kreuzzüge, der Reichtum der Kirche oder die zur Verehrung der Gottesmutter sublimierte Minne – alles galt nur, insofern es sich an der christlichen Weltordnung orientierte.
Und dass jene Ordnung weitgehend nach Ständen und nicht nach Klassen gegliedert war, half dabei, in jeder einzelnen gesellschaftlichen Gruppe eine große Fülle menschlicher Typen und Charaktere zum Vorschein zu bringen, die in einer rein meritokratischen oder kapitalistischen Ordnung nicht möglich gewesen wären: Wo nicht die Eignung bestimmt, wer welche Rolle ausübt, sondern die Geburt, und wo das Ethos einer jeden Tätigkeit letztlich in Glauben, Treue und Ehre besteht und nicht in individuellem “Können” oder gar “Erfolg”, da geschehen zwar durchaus auch Unfälle eklatanter Fehlbesetzung, doch eben auch ungeahnte moralische Glücksgriffe. Denn gelangen Reichtum und Macht an einen, der kaum die nötige Skrupellosigkeit besessen hätte, sie von sich aus an sich zu reißen, besteht eine gar nicht mal so kleine Möglichkeit, dass er sie in höherer sittlicher Würde verwaltet und seine Aufgabe eher als Pflicht, ja sogar als Opfer denn als Genuss empfindet – ein Gedanke, der freilich in unserem 21. Jahrhundert wohl kaum noch verständlich ist.
Mit der historisch bereits unzeitgemäßen Abdankung Karls V. und seinem Rückzug ins Kloster von Yuste ist dann aber schon der Beginn der zweiten, dialektisch gewissermaßen antithetischen Phase unserer abendländischen Geschichte bezeichnet. Mit der Herabwürdigung der “Una Sancta” auf die Ebene einer Konfession unter mehreren, dem Heraufdämmern der lutherischen Gnadenlehre und der Lebensverherrlichung der Renaissance begann auch ein neues Verständnis von irdischen Gütern: Protestantischer Subjektivismus und der Geltungsdrang des neuen Bürgertums gingen hier ein bedenkliches Bündnis ein, welches sowohl den gewachsenen Institutionen feindlich gegenüber stand als auch dem menschlichen Verstand eine überragende Rolle einräumte. Das Ziel sollte letztlich eine Gesellschaft sein, in der jeder das frei erlangen konnte, was ihm aufgrund von Können und Talent zustand. Doch nahm dieser Humanismus im Laufe der Jahrhunderte umso mehr dystopische Züge an, als die letzten Reste der Tradition verschwanden: Unerbittlich offenbarten sich Schritt für Schritt die ihm von Anfang an zugrundeliegenden, wenn auch noch unbewussten Absichten – bis hin zum heutigen Milliardärssozialismus.
Zum Eigentlichen vordringen – statt Drang nach “mehr”
Dies gibt uns nun aber auch einen nicht nur historischen, sondern auch moralischen Leseschlüssel für diesen Zustand. Denn weder die Kaste der Superreichen noch die Massen, denen der Boomer-Wohlstand vorenthalten geblieben ist, scheinen willens oder fähig, ihren Reichtum beziehungsweise ihre Bedürftigkeit als Gelegenheit wahrzunehmen, zum Eigentlichen durchzudringen: Wo in vergangenen Zeiten aus Armut Volksfrömmigkeit und vielfältige geistliche Berufungen entstanden waren, während Macht und Reichtum oft genug karitativen Zielen, dem Kirchenbau, dem Erziehungswesen oder der Gründung von Orden und Klöstern zugutekamen, finden wir hier auf beiden Seiten nur noch ein und denselben Drang: den nach “mehr”.
Und wenn er auch im Falle großer Bedürftigkeit weniger zu verurteilen ist als in dem gewaltigen Reichtums, tappen beide Teile der Gesellschaft doch in dieselbe Falle des Materialismus; eine Falle, in die übrigens auch der sogenannte “Konservatismus” schon seit einigen Jahrzehnten geraten ist, indem er politische Entscheidungen nicht mehr in Hinblick auf die ultimativen Seinsfragen des Abendlands bewertet, sondern auf die Illusion einer optimalen gesellschaftlichen Ordnung. Und wenn diese Ordnung zugegebenermaßen auch hier und da ein wenig mehr Restbestände abgestorbener Tradition enthalten mag als ihre sozialistischen, liberalistischen oder ökologistischen Alternativen, so ist der Grundfehler doch derselbe: Transzendenz wird als reine “Privatsache” aus den Überlegungen zur Ordnung der zwischenmenschlichen Beziehungen ausgeblendet und jene rein rationalistisch-materialistisch begriffen, als ob eine irdische Utopie die Voraussetzung für echte Gottesfurcht sein könne und nicht umgekehrt.
Somit stellt sich aber auch die Frage, inwieweit die konservativ-populistische Kehrtwende einiger Milliardäre, wie sie in den letzten Jahren zu beobachten war, nun wirklich begrüßenswert ist oder doch nur die gegenwärtigen Fehlentwicklungen, wenn auch unter anderer Flagge, befördern wird. Die Antwort fällt nicht leicht. Sicherlich mag man es auf den ersten Blick nur befürworten, wenn zumindest ein Teil des Geldes, das durch die Umschichtung von der Mittel- zur Oberschicht und die Entwicklung moralisch mehr als fragwürdiger Technologie generiert wird – man denke an KI, Kybernetik, Gen-Technologie und diverse Formen des Transhumanismus –, in die Unterstützung “konservativer” Anliegen fließt. Kann es jedoch ein gutes Leben im schlechten geben, heiligt der Zweck die Mittel? Sicher, immer ist Politik auch die Kunst des Möglichen, und niemand wird wohl von einem heutigen Staatsmann ernsthaft erwarten, so zu agieren wie weiland Ludwig der Heilige oder Philipp II. Bereits kleine Schritte, die vom allgegenwärtigen Materialismus, Hedonismus und Nihilismus wegführen würden, dürfen schon als Erfolge betrachtet werden.
Musks “faustischer” Drang ist typisch abendländisch
Aber sind diese Schritte von unseren neuen Cäsaren zu erwarten? Betrachten wir Elon Musk als Musterbeispiel, fällt die Antwort eher negativ aus: Glauben, Tradition, Familie oder Heimatverbundenheit wird man wohl kaum voraussetzen dürfen, dafür umso mehr Transhumanismus, Nationalismus, Progressivismus, Szientismus und Liberalismus. Freilich, seine bisherigen Leistungen und noch beeindruckenderen Projekte zeugen von dem gewaltigen, typisch abendländischen “faustischen” Drang Musks, sind aber letztlich nur nach außen gerichtet und lassen ihn eher als Archetyp des Abendländers in seiner letzten, materialistisch-expansiven Phase anstatt als Prototyp einer echten Umkehr nach innen erscheinen.
Der Katholizismus des sonstigen Trump-Umfelds mag zwar einige dieser bedenklichen Eindrücke wieder einfangen und durch seinen militanten anti-woken und dezidiert traditionalistischen Charakter durchaus bestechen, allein fehlt es ihm in eklatanter Weise an dem, was auch für das politische Christentum bei aller berechtigen und notwendigen Militanz zentrales Wesensmerkmal sein sollte: Innerlichkeit, Demut und Liebe.
Und doch: Sich im Politischen unter Verweis auf ein weitgehend verschwundenes Ideal von der Realität abzuwenden, würde bedeuten, einen analogen Fehler zum Irrtum des modernen Konservatismus zu begehen, der seinerseits das Jenseits zugunsten eines diesseitigen gesellschaftlichen Idealbilds aufgegeben hat. “Civitas terrena” und “civitas caelestis”, der irdische und der himmlisch-göttliche Staat, sind heute wie zur Zeit des heiligen Augustinus weitgehend getrennte Welten. Auch wenn Letzterer ein Idealbild darstellt, dem es ebenfalls im Hier und Jetzt nachzustreben gilt, ist seine Verwirklichung doch in Anbetracht der menschlichen Sündhaftigkeit hoffnungslos. Auch hier muss daher gelten: “Seid klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben” (Mt 10,16). Das Leben der großen Zivilisationen ist, ebenso wie die Existenz des Einzelnen, von der Zufälligkeit des Materiellen behaftet, daher wird man auch im Abendland den Aufstieg der neuen Cäsaren wie damals in der Antike als ein Symptom des Alterns und Vergehens wahrnehmen müssen, zu dem keine wirkliche Alternative besteht. Auch wenn diese Einsicht keineswegs bedeutet, sich mit diesen Tendenzen gemein machen zu müssen, so ist es doch gleichzeitig die Pflicht des Gläubigen, zumindest das Schlimmste zu verhindern und dort, wo noch echte Keime der Tradition vorhanden sind, schützend einzugreifen und an die Nachfahren zu denken. Und geht aus dem Cäsarismus nicht früher oder später in jeder Hochkultur ein augusteischer, höchst religionsaffiner Zivilisationsstaat hervor?
Katakomben oder Konstantin?
Freilich wird auch dieser seine Restaurationspolitik zwar eher auf eine kulturpatriotische Interpretation der Religion stützen und sich mit den äußeren Formen zufriedengeben, da eine echte innere Rückbesinnung noch weitgehend undenkbar ist. Aber wäre die Fortsetzung des gegenwärtigen geistlichen Niedergangs mithilfe staatlicher Förderung etwa die bessere Alternative? Und kann nicht erst unter der Voraussetzung einer neuen “konstantinischen Wende” von oben wieder eine allmähliche Durchdringung auch der breiteren Massen mit christlichem Gedankengut sich vollziehen? Wann gilt es, die Katakomben zu verlassen, um den Glauben von einer Elitenerscheinung wieder zu einem Massenphänomen zu machen?
Dies werden die schwierigen Fragen sein, auf die die nächsten Generationen eine Antwort werden finden müssen. Diese Situation ist herausfordernd, aber doch nicht ganz ungewohnt. Schließlich gehört es zum Schicksal des Christen, in einer unbeständigen Welt sowohl seinem Glauben treu zu bleiben als auch nach bestem Wissen und Gewissen an der Ordnung der Welt mitzuarbeiten, die freilich immer nur eine vorübergehende und unvollständige sein kann: “Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist” (Mt 22,21).
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.
Themen & Autoren
David Engels
Jesus Christus
Katholizismus
Kreuzzüge
Martin Luther
Mutter Jesu Maria
Philipp II.
Traditionen
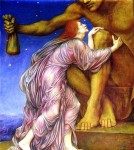 Quelle
Quelle

Schreibe einen Kommentar