Niklaus von Flüe: Mystiker und Schweizer Nationalheiliger
Eine Tafel aus der Amtlichen Luzerner Chronik von 1513 von Diebold Schilling dem Jüngeren, die die Ereignisse der Tagsatzung von Stans im Jahr 1481 illustriert. Oben: Ein Priester namens Heini am Grund besucht Niklaus von Flüe, um ihn um Rat zu bitten, wie die scheiternde Tagsatzung in Stans gerettet werden kann, wo sich die Delegierten der ländlichen und städtischen Kantone der Alten Eidgenossenschaft nicht einigen konnten und mit einem Bürgerkrieg drohten. Unten: Am Grund kehrt zur Tagsatzung zurück und berichtet von Niklaus’ Ratschlag, woraufhin die Delegierten einen Kompromiss schließen. Am Grund wird gezeigt, wie er einen Vogt zurückhält, der schon losziehen und die gute Nachricht verbreiten will: Niklaus’ Ratschlag bleibt bis heute geheim.
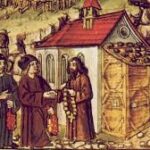 Quelle
Quelle
heiligederschweiz.ch – Niklaus von Flüe
Gesellschaft & Religion – “Niklaus von Flüe zieht mich in die Tiefe” – Kultur – SRF
Von Alexander Folz
Redaktion – Donnerstag, 25. September 2025
Heute ehrt die katholische Kirche Niklaus von Flüe (1417–1487), den als “Bruder Klaus” bekannten Mystiker und Schweizer Nationalheiligen. Er durchlief eine radikale Lebenswende vom erfolgreichen Bergbauern, Politiker und zehnfachen Familienvater zum asketischen Einsiedler, der 19 Jahre lang ausschließlich von der Heiligen Kommunion und von Wasser lebte.
Geboren 1417 als Sohn des wohlhabenden Bauern Heinrich von Flüe und dessen Frau Hemma Ruobert in Flüeli bei Sachseln im Kanton Obwalden, wuchs Niklaus in eine Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche hinein. Bereits in seiner Jugend zeichnete ihn eine außergewöhnliche Spiritualität aus. Zeitgenossen beschrieben ihn als “züchtigen, gütigen, tugendhaften, frommen und wahrhaften Menschen”, der schon früh eine Neigung zu einsamen Gebetszeiten und asketischen Übungen zeigte.
Als Offizier nahm Niklaus von 1440 bis 1444 am Alten Zürichkrieg teil und beteiligte sich später am Thurgauerkrieg gegen Erzherzog Sigismund von Österreich. Er stieg zum Hauptmann auf und kämpfte nach zeitgenössischen Berichten mit dem Schwert in einer Hand und dem Rosenkranz in der anderen.
Nach seinem Militärdienst heiratete er um 1445/46 Dorothea Wyss, die Tochter des Ratsherrn Rudi Wyss aus der Schwändi oberhalb von Sarnen. Aus dieser Ehe gingen zehn Kinder hervor – fünf Söhne und fünf Töchter.
Niklaus bekleidete wichtige öffentliche Ämter als Richter, Ratsherr und Vertreter Obwaldens bei der eidgenössischen Tagsatzung. Als für damalige Verhältnisse wohlhabender Bauer bewirtschaftete er erfolgreich seinen Hof im Flüeli und genoss hohes gesellschaftliches Ansehen.
Die mystische Wende
Bereits seit seiner Kindheit erlebte Niklaus Erscheinungen, die seinen spirituellen Weg prägten. Im Alter von 16 Jahren sah er in einer Vision einen hohen Turm an jener Stelle im Ranft, wo er später seine Einsiedlerklause errichten sollte.
Um 1465 geriet Niklaus in eine tiefe existenzielle Krise. Die politische Korruption seiner Zeit und seine ungestillte Sehnsucht nach spiritueller Vervollkommnung führten dazu, dass er alle öffentlichen Ämter niederlegte. Der innere Ruf – “verlasse alles, was du liebst” – wurde immer drängender.
Der Aufbruch ins Einsiedlerleben
Im Oktober 1467 verließ der 50-jährige Niklaus mit dem ausdrücklichen Einverständnis seiner Frau Dorothea seine Familie, um als Pilger zu leben. Das jüngste Kind war noch kein Jahr alt, während der älteste Sohn Hans bereits zwanzig war und als Bauer die Familie ernähren konnte.
Zunächst pilgerte Niklaus rheinabwärts in Richtung Basel. Doch bei Liestal im Baselbiet erlebte er eine schmerzhafte Vision, die ihn zur Umkehr bewegte. Ein Bauer redete ihm ins Gewissen, er solle heimkehren. Anschließend stellte Niklaus fest, dass er seit elf Tagen weder gegessen noch getrunken hatte.
Zurück in der Heimat übernachtete er unerkannt im Stall seines eigenen Hauses und zog sich zunächst auf die Chlisterlialp zurück, wo er von Jägern entdeckt wurde. Schließlich ließ er sich von einer Vision geleitet in der Ranftschlucht nieder, nur wenige Minuten von seinem Familienhaus entfernt.
Leben als Bruder Klaus im Ranft
Ende 1467 baute sich Niklaus zunächst ein primitives “Cluselin” aus Ästen, Holz und Laub. Bereits 1468 errichteten ihm Mitbürger, Freunde und Nachbarn eine richtige Klause mit angebauter Kapelle.
Die an die Kapelle angelehnte Zelle entspricht in Form und Material noch heute weitgehend dem Original. Sie verfügt über zwei Fenster – eines zum Altar auf Gott hin ausgerichtet, das andere nach außen zur Welt geöffnet.
In dieser einfachen Behausung ohne Stuhl oder Bett, mit nur einem Stein als Kopfkissen, lebte Bruder Klaus 20 Jahre bis zu seinem Tod am 21. März 1487.
Das Wunderfasten
Die wohl außergewöhnlichste Facette von Bruder Klaus’ Einsiedlerleben war seine extreme Askese. Seit dem 16. Oktober 1467 nahm er nachweislich keine feste Nahrung mehr zu sich.
Seine einzige Stärkung erhielt er durch die Heilige Kommunion, die er zunächst nur an hohen Festen und später etwa einmal im Monat empfing. Durch das zur Kapelle gerichtete Fenster seiner Zelle konnte er an der “geistlichen Kommunion” teilhaben, wenn der Priester die Messe zelebrierte.
Diese 19-jährige Nahrungslosigkeit stieß auf erhebliche Skepsis. Seine Gegner organisierten eine einmonatige Rundumüberwachung durch 30 Mann, um einen möglichen Betrug aufzudecken.
Die Wachen mussten jedoch bestätigen, dass Bruder Klaus weder Essen noch Trinken zu sich nahm. Selbst der Konstanzer Weihbischof Thomas unterzog ihn einer Prüfung und befahl ihm, zur Probe ein Stück Brot und einen Becher Wein zu sich zu nehmen – was Bruder Klaus sofort wieder erbrach.
Auf die Frage nach seiner Nahrungslosigkeit antwortete er stets: “Guter Vater, ich habe nie gesagt und sage nicht, dass ich nichts esse”. Bruder Klaus hütete sich zeitlebens davor, sich seiner Abstinenz zu rühmen, und sah sie als eine Gnade Gottes, die er weder hinterfragen noch deuten wollte.
Mystische Visionen
Bruder Klaus erlebte während seines Lebens mehrere bedeutsame Visionen, die von Zeitgenossen sorgfältig dokumentiert wurden. Bereits im Mutterleib soll er einen Stern, einen Stein und Heiliges Öl gesehen haben.
Diese Vision deutete er später als Zeichen seiner königlichen Berufung durch die Taufe, seiner Bestimmung zu Treue und Zuverlässigkeit sowie seiner Aufgabe, Menschen zu leuchten und Orientierung zu geben.
Eine besonders bedeutsame Vision war die der “drei wohlgestalteten Männer”, die er als Sinnbild des dreifaltigen Gottes interpretierte und die seine Entscheidung bestärkte, fortan restlos Gott zu dienen. Die „Wolkenvision“ und andere mystische Erfahrungen prägten seinen spirituellen Weg und flossen in seine Beratertätigkeit ein.
Friedensstifter und Ratgeber
Trotz seiner selbstgewählten Isolation wurde Bruder Klaus zu einem europaweit gefragten Ratgeber. Pilger aus ganz Europa suchten seine Einsiedelei im Ranft auf, darunter hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Kirche. Der Mailänder Gesandte berichtete 1483 erstaunt: “Ich fand ihn über alles informiert”, obwohl Bruder Klaus weder lesen noch schreiben konnte.
Seine bedeutendste politische Intervention erfolgte 1481 beim “Stanser Verkommnis”. Die eidgenössischen Orte standen vor einem Bürgerkrieg, nachdem die Burgunderkriege zu schweren internen Spannungen geführt hatten. Die Aufnahme der Städte Freiburg und Solothurn in die Eidgenossenschaft drohte das Gleichgewicht zwischen Stadt- und Landorten zu zerstören.
Vom 18. bis 22. Dezember 1481 rang die Tagsatzung in Stans um eine Einigung. Erst der versöhnliche Rat von Bruder Klaus, überbracht durch den Stanser Pfarrer Heimo Amgrund, brachte den Durchbruch. Das Abkommen wurde “aus göttlichem Mund” – wie es in den Dokumenten heißt – in letzter Minute unterzeichnet. Der genaue Wortlaut seiner Botschaft ist nicht überliefert, doch die Einleitung des Vertrags lese sich “wie eine frei wiedergegebene Predigt” des Eremiten.
Ein Jahr später ließ Bruder Klaus einen Brief an den Rat von Bern senden, in dem er seine Friedensphilosophie zusammenfasste: “Darum sönd ir luogen, dz ir enandren ghorsam syend” – “Darum sollt ihr euch bemühen, einander gehorsam zu sein”. Dieses Prinzip gegenseitiger Achtung und des Zuhörens gilt als eine der Grundlagen der Schweizer Neutralität.
Dorothea Wyss – die Frau im Hintergrund
Eine zentrale Rolle in Niklaus’ Leben spielte seine Ehefrau Dorothea Wyss (um 1430–1495/96). Nach dem Weggang ihres Mannes übernahm sie als Familienoberhaupt die Leitung von Haus und Hof sowie die Erziehung der zehn Kinder. Zeitgenossen beschrieben sie als “eine heiligmäßige Frau”, die mit großen Herausforderungen konfrontiert war und diese meisterte.
Dorothea war keineswegs das passive Opfer eines egoistischen Ehemanns, wie es mitunter dargestellt wird. Kirchenrechtlich war das Einverständnis der Ehefrau für einen solchen Schritt zwingend erforderlich.
Sie nähte sogar das Büßergewand, das Niklaus beim Abschied trug. Trotz der räumlichen Trennung blieb das Ehepaar bis zum Tod verbunden. Als Niklaus 1487 starb, soll ein Engel Dorothea persönlich über seinen Tod und seine Aufnahme in den Himmel berichtet haben.
Erhalten Sie Top-Nachrichten von CNA Deutsch direkt via WhatsApp und Telegram.
Schluss mit der Suche nach katholischen Nachrichten – Hier kommen sie zu Ihnen.
Tags:


Schreibe einen Kommentar