100. Geburtstag Jean Raspail
Chronist des Untergangs, Verteidiger des Eigenen – Jean Raspail ist mehr als nur der Autor des prophetischen “Heerlagers der Heiligen”. In der “Axt aus der Steppe” zeigt sich Raspail als brillanter Reiseautor und als Advokat bedrohter Kulturen und Traditionen
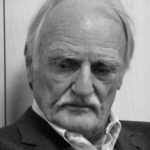 Quelle
Quelle
Der dunkle Gott und der Entdecker Amerikas | Die Tagespost
Jean Raspail – Wikipedia
Alle Bücher von Jean Raspail
Feuerland: Beim Totenwächter der Yámana am Ende der Welt – WELT
05.07.2025
Dirk Weisbrod
Am 5. Juli dieses Jahres hätte Jean Raspail seinen 100. Geburtstag gefeiert. Der 1925 in Chemillé-sur-Dême geborene und am 13. Juni 2020 im Alter von fast 95 Jahren in Paris gestorbene Franzose galt im linksintellektuellen Milieu als “umstrittener”, ja sogar als “toxischer” Autor. In Frankreich erregte der Monarchist und Anhänger der katholischen Tradition mit seiner Opposition gegen die Revolution von 1789 und die Republik Anstoß.
Hierzulande wurde Raspail vor allem mit seinem Roman „Das Heerlager der Heiligen“ bekannt, ein Buch, das – insbesondere nach 2015 – viele gelesen haben dürften, ohne darüber zu sprechen. Der 1973 erschienene Roman beschreibt die Invasion Frankreichs durch indische Migranten, deren Ankunft von einer im Sterben liegenden und intellektuell wie moralisch verwahrlosten Gesellschaft hysterisch herbeigesehnt wird, die unter dem Ansturm schließlich zusammenbricht. Große Aufmerksamkeit widmete Raspail im „Heerlager“ jenen, die sich der kollektiven Hysterie entgegenstellen, Menschen auf verlorenem Posten, die durchhalten und weitertragen wollen – und doch untergehen. Dieses Ausharren, dieses Bewusstsein für die Bedeutung uralter Traditionen, die nur um den Preis des Untergangs aufgegeben werden können, ist das eigentliche Zentrum des raspailschen Werkes.
Das unmittelbar auf das “Heerlager” folgende Werk, das Raspail 1974 unter dem Titel “La hache des steppes” (deutsch: “Die Axt aus der Steppe: Reisen auf verwehten Spuren”) veröffentlichte, ist die empirische und fantasievolle Ausarbeitung seines Standpunkts. Es handelt sich um einen romanhaften Reisebericht – das originäre Genre Raspails. Aus einer großbürgerlichen Familie stammend – der Vater war Industrieller – schlug Raspail seinen eigenen Weg ein. Es war der Weg zu den aussterbenden Völkern Asiens, Südamerikas und der Karibik, einerseits als Teilnehmer und schließlich Leiter von Expeditionen in den 40er und 50er Jahren, andererseits als Chronist dieser Reisen, wobei Raspails Schriften immer mehr den Charakter epischer Fiktionen über den Verlust der Identität dieser Völker annahmen. Gipfelpunkt dieser ethnographischen Epen ist der 1986 veröffentlichte Roman “Qui se souvient des hommes …”, der unter dem Titel “Sie waren die ersten. Tragödie und Ende der Feuerlandindianer” ins Deutsche übersetzt wurde. Raspail beschreibt beziehungsweise imaginiert darin die 10.000-jährige Geschichte der feuerländischen Alakaluf, die in der Begegnung mit den europäischen Eroberern ihre Identität verlieren und schließlich untergehen.
Poetik zwischen Fakt und Fiktion
Bei der titelgebenden “Axt aus der Steppe” handelt es sich um ein Objekt “aus unsterblichem schwarzen Stein”, die ein gotischer Handwerker vor dreitausend Jahren aus dem Basalt einer Ostseeinsel fertigte und die sich seitdem, so behauptet der Autor, im Besitz seiner Familie befindet. Die Vorfahren, davon ist Raspail überzeugt, waren Westgoten, die aus dem Osten, als Antreiber und Getriebene der Völkerwanderung, in den Süden Frankreichs zogen. Dass der Autor sich dabei auf ein offensichtlich imaginiertes Memorandum eines Vorfahren stützt, Fakten und Fiktion vermischt, gehört zur augenzwinkernden raspailschen Poetik: Das Memorandum endet mit dem Untergang einer ganz offensichtlich erfundenen Linie westgotischer Untergrundkönige am letzten Tag des Jahres 999 – der poetische Schwindel ist somit nur für den erkennbar, der das entsprechende Geschichtsbewusstsein hat.
Auch die Imagination einer von Generation zu Generation weitergegebenen Axt hat etwas mit diesem Bewusstsein zu tun, das dem modernen Menschen weitgehend abhandengekommen ist. Herkunft ist Schicksal, für die Familie Raspail eben ein westgotisches Schicksal: “Die Nation der Westgoten auf dem Marsch ist auf das Wesentliche konzentriert. Keine Heimatscholle, die plebejisch an den Stiefeln klebt, nur die Vereinigung des Fleisches und die Gemeinschaft der Seelen im Poltern der Fuhrwerke und Pferde. Eine Nation!” Eine Nation, die untergehen wird, aber auch eine Nation, die Nachfahren hat; auch wenn sie die einstige Sprache, ihre Sitten und Mythen vergessen und in etwas anderem aufgehen wird. Sich einer solchen Herkunft bewusst zu werden, ist anhand der belegbaren genealogischen Daten fast unmöglich, denn die meisten Menschen sind kaum in der Lage, sich an die Namen der eigenen Urgroßeltern zu erinnern. Sie könnten “den zerrissenen Faden” der Erinnerung aber “mit Hilfe der Vorstellungskraft überbrücken”, so wie die Geschichte der Basalt-Axt Raspails Vorstellungskraft entsprungen ist: “Wer weiß, ob sie sich nicht bisweilen den verlorenen Tatsachen annähern? So vergeblich es auch sein mag, dieses wunderbare Ereignis rettet ihre Einzigartigkeit.” Dies gelingt aber, so der Autor, nur einer Minderheit.
Ein melancholischer Versuch
Die einzelnen Stationen des Reiseberichts sind nichts anderes, als Raspails melancholischer Versuch, noch einmal eine aussterbende Sprache oder fast vergessene Mythen zu hören und einen jener Einzigartigen zu treffen, die sich ihrer Herkunft bewusst sind. Oft kommt er zu spät, steht an Gräbern, hört Geschichten aus zweiter Hand oder schaut in verständnislose Mienen, etwa bei der Suche nach den Ainu, den Ureinwohnern Japans, den Arawak auf Haiti, dem Andenvolk der Uru oder den schon erwähnten Feuerlandindianern. Auch das Schicksal der Soldaten Napoleons, die 1812 in Russland blieben und im Weiler Katlinka Familien gründeten, bleibt ungewiss. Angehörige der Wehrmacht hatten noch 1941 deren Nachkommen angetroffen. Haben sie Stalin und die Sowjetunion überlebt?
Manchmal kann der Autor einen zerrissenen Faden noch einmal aufheben. Etwa bei den Nachfahren der 451 vom Römer Aëtius auf den Katalaunischen Feldern geschlagenen Hunnen, die noch 1973 in Origny-le-Sec leben. Als Raspail das Dorf aufsucht, erinnern sich die Älteren stolz an diese Überlieferung. Aber auch sie wird versiegen. Denn, so stellt einer der Alten resigniert fest, “seit es eben die Glotze gibt, kenne ich unter den wenigen, die hiergeblieben sind, nicht einen Jungen, der sich dafür interessieren würde.”
Die Kariben, die Raspail in den 50er Jahren auf der Insel Domenica kurz nach Ende der englischen Kolonialzeit antrifft, haben in der Begegnung mit der europäischen Kultur ihre Sprache gegen Englisch und Kreolisch eingetauscht und ihre Mythen vergessen. Nur ein alter Häuptling kennt noch ein Lied in der karibischen Sprache: “Der Singsang der Kariben: ihr eigenes Latein, das sie nicht mehr verstanden. Ein verlorener Glaube.” Es spricht für die Treffsicherheit seiner Diagnose, dass Raspail dieses Erlebnis mit einem Exkurs illustriert, der nach Europa weist.
Christentum als abendländische Angelegenheit?
1956 hatte Raspail bei einem Besuch in Nagasaki an einer “Messe” japanischer Untergrund-Katholiken teilgenommen. Als Nachkommen der ersten japanischen Christen, die seit dem 17. Jahrhundert brutal unterdrückt wurden, feierten sie einen Gottesdienst ohne Priester, mit Reisbiskuits und Sake sowie Gebeten in einer Sprache, die Raspail noch als Latein identifizieren konnte. Rudimente einer fast vergessenen Liturgie, jedoch in einem tiefen Glauben zelebriert. Eingeschüchtert hielten sie auch nach Ende der Verfolgung noch hundert Jahre an den konspirativen Messen fest, geschützt von Spähern vor den Türen der Gebetsräume – bis die Reformen des II. Vaticanums auch in Japan einzogen: “Leider! Fünfzehn Jahre später eroberte die katholische Konzilskirche die Festung. Sie gaben nach. Nach langer Überredung hat man ihnen echte Priester aufgezwungen, vom allerneuesten Modell, mit Garantie, man hat drei Jahrhunderte eines igelgleichen Glaubens ausgelöscht, der mehr wert war als alle elenden Bußübungen zusammen, über die Rom zu Fall kommt.”
Raspail optierte stets für die ursprünglichen Bräuche der bedrohten Völker und machte dabei auch die christliche Mission als potenzielle Bedrohung für die Überlieferungen der Missionierten aus. Für den gläubigen Katholiken war das Christentum vor allem eine abendländische Angelegenheit. So ist auch die “Axt aus der Steppe” ein exzellent komponiertes und brillant geschriebenes Plädoyer für die je eigenen Traditionen – die noch lebendigen und die bereits vergessenen.
Jean Raspail: Die Axt aus der Steppe: Reisen auf verwehten Spuren, Wien: Karolinger Verlag, 2019, 280 Seiten, gebunden, EUR 24,–
Der Autor dieses Textes ist Informationswissenschaftler und Bibliothekar. Seit 2019 ist er Herausgeber des “VATICAN Magazins”.
Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.
Dirk WeisbrodChristliche MissionJean RaspailJosef StalinKatholikinnen und KatholikenTraditionen


Schreibe einen Kommentar