Geniestreich mit Schönheitsfehlern
Bis heute verbindet man mit G. K. Chesterton die Father-Brown-Krimis
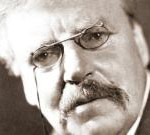 G.K. Chesterton: Weitere Beiträge
G.K. Chesterton: Weitere Beiträge
Der Mann der Donnerstag war
Doch auch sein Roman “Der Mann, der Donnerstag war” macht ihn trotz einiger Schwächen zum grossen Schriftsteller. Eine literarische Entdeckungsreise lohnt sich sehr.
Von Michael Hanke
Die Tagespost, 28. Januar 2015
Gilbert Keith Chestertons (1874–1936) Ruhm ist unlöslich mit dem seines berühmtesten Helden verbunden. Denn wer denkt bei der Nennung des Namens Chesterton – in seiner englischen Heimat schlicht G.K.C. – nicht sogleich an Father Brown, jenen kleinen katholischen Geistlichen, der uns mit seiner “komischen Mischung aus Plattheit und heiliger Einfalt”, bereits in der ersten der ihm gewidmeten fünfzig Geschichten, “Das blaue Kreuz“, zunächst zum Lachen, dann aber zum Nachdenken bringt?
Bis heute werden diese Detektivgeschichten allzu oft als römisch-katholische Propaganda abgetan, obwohl selbst ein abgebrühter Atheist wie der Romancier Kingsley Amis sie längst (und mit schlagenden Argumenten) zu den literarischen Glanzleistungen ihres Genres rechnet. Sie belegen, dass der Mann mit dem Gesicht “so rund und öde wie ein Norfolk-Knödel” alles andere ist als platt und einfältig. Nur verdanken sich seine kriminalistischen Erfolge eben nicht der kühl kalkulierenden, fast schon unmenschlich wirkenden Ratio eines Sherlock Holmes, sondern der Demut des Seelenhirten, dem sittliche Niederungen aus dem Beichtgespräch und der eigenen Vorstellungskraft so vertraut sind, dass ein überführter Mörder ihn bestürzt fragt, ob er der Teufel sei. Nein, lautet die paradoxe Antwort: Er sei Mensch und trage deshalb alle Teufel im Herzen.
Die Paradoxie ist ein Markenzeichen Chestertons. Deshalb liegt der Verdacht nahe, dass in Father Brown vielleicht doch mehr von seinem Schöpfer steckt als von Father John O’Connor (1870–1952), jenem irischen, in Yorkshire tätigen Geistlichen, dem Chesterton als Vorbild des Priesterdetektivs in seiner Autobiographie ein Denkmal gesetzt hat. Der schlanke Father O’Connor hatte äusserlich wenig mit Father Brown gemeinsam, aber einen vergleichbaren Scharfsinn und zudem ein beneidenswertes sprachliches Talent, das ihm gestattete, Werke von Claudel und Maritain ins Englische zu übertragen. Doch es war Chesterton, nicht Father O’Connor, der als junger Mann im Sog der viktorianischen Endzeitströmung des Nihilismus zu versinken drohte. Er erkannte die Gefahr und zog sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf, indem er in seinem Roman “Der Mann, der Donnerstag war”, aus der Existenz des Bösen auf die des Guten schliesst. Kafka schrieb nach der Lektüre des Romans über dessen Verfasser: “Er ist so lustig, dass man fast glauben könnte, er habe Gott gefunden.”
1908 entstanden und publiziert, wurde der Roman über Nacht zu einem Bestseller. Er ist es geblieben. Die Geschichte seiner Wirkung lässt sich, teils in der weltanschaulichen Substanz und teils an der Oberfläche literarischer Technik in Werk und Kritik nicht nur Kafkas, sondern auch Jorge Luis Borges’, Roy Campbells, Evelyn Waughs und weiteren Schriftstellern nachzeichnen. Und das, obwohl es sich um einen Geniestreich mit gravierenden Schönheitsfehlern handelte. Denn es war Chesterton nun einmal nicht gegeben, ein abgeschlossenes (oder für abgeschlossen gehaltenes) Werk – sei es auch nur ein Essay – nach der Niederschrift oder dem Diktat noch einmal sorgfältig durchzusehen. Brüche in der Handlungsführung, fehlerhafte Chronologie, mangelnde Motivierung finden sich in ähnlich reicher Fülle in der englischen Literatur nur noch in den Dramen Shakespeares, womit Chesterton sich immerhin in bester Gesellschaft befindet. Bis heute ereifern sich Literaturkritiker mit Verve über den vor allem gegen Ende des Romans bemerkbaren fröhlichen Leichtsinn, der den Eindruck weckt, das Buch sei in einem von Phasen der Nüchternheit gänzlich unberührt gebliebenen Rausch geschrieben. Waugh hat die Mängel des Romans klar erkannt und daraus geschlossen, dass Chesterton kein echter Künstler gewesen sei. Der nämlich sei bereit, für die Vollendung seines Werkes die eigene Seele zu opfern, Chesterton dagegen habe versucht, Seelen zu retten. Vielleicht hat Waugh ein wenig übertrieben, doch lässt sich nicht leugnen, dass die weltanschauliche Position Chestertons in diesem Roman und allen folgenden Werken der Reifezeit ebenso klar zutage liegt wie in denen seines katholischen Bundesgenossen Hilaire Belloc und selbst in denen seiner weltanschaulichen Gegner und persönlichen Freunde Bernard Shaw und H. G. Wells.
Das Thema des Romans hat Chesterton treffender auf den Punkt gebracht als irgendeiner seiner Exegeten. Er habe das menschliche Leid keineswegs leugnen, sondern ihm nur den von Gott zugedachten, dem Menschen nicht durchschaubaren Sinn zubilligen wollen. Theologisch gesprochen: Es geht um die Theodizee, und so kann es kaum überraschen, dass Chesterton dankbar auf das Buch Hiob als motivierende Quelle des Geschehens und eines grossen Teils der Bildersprache zurückgegriffen hat. Dort wird die Frage nach dem Sinn des Leidens in der göttlichen Schöpfung vom Menschen so kühn gestellt und von Gott so endgültig beantwortet, dass Chesterton dem alttestamentlichen Meisterwerk einige Jahre später einen Essay gewidmet hat.
Zum Inhalt des Romans: Ein junger Dichter namens Gabriel Syme wird unter geheimnisvollen Umständen von einem grossen Unbekannten in den englischen Geheimdienst aufgenommen und lässt sich in dessen Auftrag in den obersten Rat einer international wirkenden Terrororganisation wählen. Jedes Mitglied des erlesenen Zirkels trägt den Namen eines Wochentages (Syme ist Donnerstag), und die erste Sitzung findet unter der Leitung des schon rein physisch überwältigenden Sonntag statt. Die Herren diskutieren in aller Öffentlichkeit (auf dem Balkon eines Londoner Hotels) und zur Erheiterung der hin- und hereilenden Kellner die Ermordung des Zaren während eines Staatsbesuchs in Frankreich. Der scheinbar auf verlorenem Posten kämpfende Syme entdeckt im Laufe der folgenden Tage, dass alle Terroristen wie er selbst maskierte Geheimpolizisten sind. Wer aber ist ihr brutaler Chef Sonntag? Wie können sie ihn stellen? Eine wilde Verfolgungsjagd führt sie in sein Haus auf dem Lande, wo er zu einem Maskenball einlädt und sich als jener geheimnisvolle Leiter des Geheimdienstes zu erkennen gibt, der sie alle angeworben hat. Mit welchem Recht, so die Frage, hat er sie gequält, um sie – wie er es formuliert – zum Frieden Gottes, zu sich selbst, zu führen? Mit welchem Recht darf er, der nicht mit ihnen gelitten hat, andere leiden lassen? Syme erhält eine Antwort, die er irgendwo schon einmal gehört zu haben glaubt: “Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke?“ Die implizierte Antwort liegt auf der Hand.
Bedenkt man, dass Chesterton mehr als fünfzehn Jahre nach der Publikation des Romans und lange, nachdem ihn sein Freund Belloc zum hoffnungslosen Fall erklärt hatte, den Weg in die Kirche fand, ist man geneigt zu sagen: Die Essaysammlung “Orthodoxie“ und die Fantasia “Der Mann, der Donnerstag war” zeigen uns einen Mann, der sich des rechten Weges wohl bewusst, des eigenen Gehvermögens jedoch noch nicht recht sicher war. Monsignore Ronald Knox, der ihm half, den letzten Schritt zu tun, hat scherzhaft bemerkt, dass “Der Mann, der Donnerstag war“ als pantheistische Heilsbotschaft missverstanden werden könnte, wenn Chesterton das optimistische Ende des Romans nicht durch den Auftritt eines dem Teufel tatsächlich hörigen Anarchisten relativiert hätte. Der Kampf für das Gute impliziert die Präsenz des Bösen. Daher behauptet Knox mit Recht, Chesterton habe sich im “Der Mann, der Donnerstag war“ auf die Suche nach der eigenen Seele gemacht und sie gefunden. Es gibt, wie Chesterton schreibt, kein schlimmeres Übel als die “unverzeihliche Sünde, keine Vergebung anzustreben“. Die oft gestellte Frage, wie “Der Mann, der Donnerstag war“ gattungsmässig zu etikettieren sei (als Novelle, Roman, Utopie oder, laut Chesterton, schlicht als Alptraum?) ist damit hinfällig. Es handelt sich – wie beim höfischen Roman des Mittelalters – um eine klassische Initiationsgeschichte, in der die lockere Reihung von aventiuren (Abenteuer) zur Entdeckung des eigenen Wesens führt.
Chesterton schreibt weiter, die in der Erzählung gestellte Frage laute nicht, ob es das Böse gebe, sondern nur, ob angesichts des Bösen alles böse sei. Sie erkläre nicht die ganze Objektwelt zum Alptraum, sondern nur jene Aspekte, die einem unausgegorenen jungen Pessimisten zum Ausklang des 19. Jahrhunderts als solche erscheinen mochten. Im Übrigen sei der scheinbar brutale, im Verborgenen aber wohlwollend agierende Sonntag nicht so sehr Gott im religiösen oder im nicht-religiösen Sinne, sondern die Natur, wie sie dem Pantheisten erscheine, dessen Weltanschauung im Kampf gegen den Pessimismus liege. Ist Chesterton noch aktuell? Belloc schrieb, dass die Antwort davon abhängt, ob wir bereit sind, uns auf die Fülle seiner Gedanken und auf die Variabilität seines literarischen Schaffens einzulassen. Chesterton ist nicht der leichtsinnige Optimist, als der er von weltanschaulich indifferenten Kritikern gern in Anspruch genommen wird mit der Absicht, ihn auf diese Weise auf dem Abfallhaufen der Literaturgeschichte deponieren zu können.
Noch vor dreissig Jahren glaubte ein so ausgezeichneter Kenner der englischen Literatur wie Ulrich Suerbaum mit taktvoller Herablassung konstatieren zu dürfen: “Heute ist der grosse Literat Chesterton nur noch ein Name ohne Resonanz, und seine eigene Chance, das Etikett des ‘Meisters, der nie ein Meisterwerk schrieb’, loszuwerden, besteht darin, dass die Father-Brown-Geschichten als Meisterwerk anerkannt und einige verwandte Erzählwerke für voll genommen werden.“ Inzwischen sind zwei Dutzend Bücher (Monographien und mindestens vier wuchtige Biographien) erschienen, die das Interesse am Literaten und Kulturkritiker Chesterton nicht nur wachgehalten, sondern im Falle junger Leser erst geweckt haben. Im Gegensatz zu Shaw und Wells, denen kaum noch jemand intellektuelles Format zuerkennt, ist Chesterton so aktuell wie nie zuvor. In den englischsprachigen Ländern wird seine Haltung zu Abtreibung, Euthanasie, Feminismus, Kapitalismus und Sozialismus so eifrig diskutiert wie nicht einmal zu seinen Lebzeiten.
Suerbaum hat schlicht übersehen, dass Chesterton in der Weltliteratur, darunter auch in der deutschen Erzählkunst, allenthalben Spuren hinterlassen hat. Der stämmige Dr. Bull mit seiner furchteinflössenden Sonnenbrille findet in Siegfried Lenz’ Novelle “Feuerschiff“ in der Gestalt von Dr. Caspary einen Nachfolger, der Geheimdienstchef Sonntag in Dürrenmatts Kriminalroman “Der Richter und sein Henker“ in Gestalt des Kommissar Bärlach. Und falls Kafka den “Mann, der Donnerstag war“ vor Abfassung seiner Parabel “Gibs auf!“ gelesen haben sollte, so hätte er der Atmosphäre und dem Zentralthema von Chestertons Erzählung einen pessimistischen Drall gegeben, der einen Gedanken von C. S. Lewis in Erinnerung ruft. Kafka und Chesterton miteinander vergleichend, stellt Lewis die Frage, ob der Unterschied zwischen den beiden Autoren vielleicht darin bestehe, dass der eine ‘überholt‘ (dated), der andere zeitgemäss sei? “Oder“, wie Lewis weiter fragt, “ist es vielleicht so, dass beide ein gleichermassen eindringliches Bild von der Verlassenheit und Verunsicherung zeichnen, die jeder von uns in seinem (vermeintlich) einsamen Kampf mit dem Universum erfährt, dass aber Chesterton dem Universum eine raffiniertere Tarnung zuschreibt als Kafka und einräumt, dass dieser Kampf sowohl Entsetzen wie Entzücken auslösen kann; ist es vielleicht so, das Chesterton stärker in die Tiefe geht, dass er ausgewogener und sein Werk somit klassischer, beständiger ist?”
Diese Ausgewogenheit konstatiert auch Borges: “Das gewaltige (powerful) Werk Chestertons steht – als Inbegriff physischer und moralischer Gesundheit – immer auf der Schwelle zum Alptraum. Zwischen den Zeilen lauert das Diabolische und das Schreckliche.“ Und nur scheinbar widerspricht Kingsley Amis dieser Einsicht, wenn er einen nicht minder wichtigen Gesichtspunkt für die andauernde Faszinationskraft dieses Autors anführt: “Sollte Chesterton Optimist gewesen sein (keine schlechte Sache übrigens, falls man dazu in der Lage sein sollte), so vor allem deshalb, weil er die Welt liebte, die sein Gott geschaffen hatte, und weil er nicht müde wurde, sich an einer ihrer wichtigsten Erscheinungsformen zu erfreuen: ihrer Oberfläche.”





Schreibe einen Kommentar